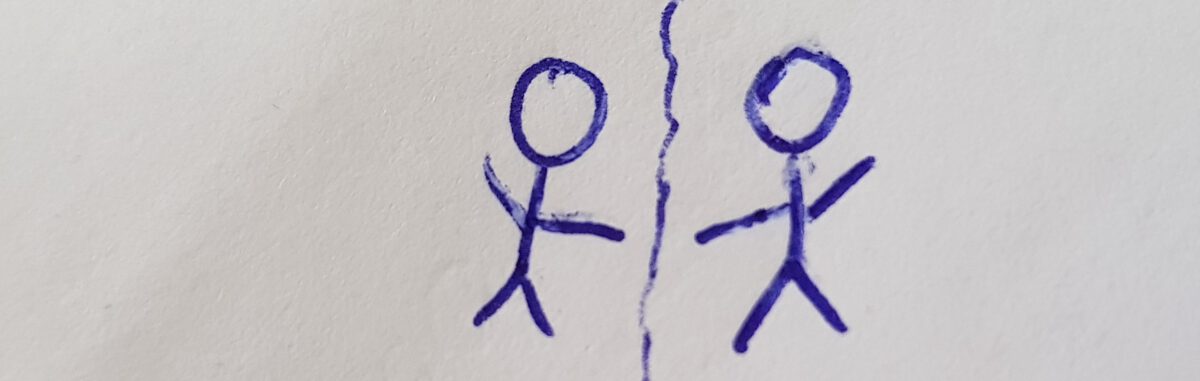Noch immer, während ich dies schreibe, habe ich Die folgende Geschichte von Cees Nooteboom nicht ausgelesen und schreibe bereits den zweiten von diesem Buch inspirierten Blogeintrag. Den ersten findet ihr hier: Figurenbeschreibung und -kommunikation. Doch jetzt soll es um Gedanken zu einem kurzen Abschnitt des Werkes gehen:
»Abend in meiner Erinnerung, Abend in Lissabon. Die Lichter der Stadt waren angegangen, mein Blick war ein Vogel geworden, der ziellos über die Straßen flog. Es war kühl geworden, da oben, die Stimmen der Kinder waren aus den Gärten verschwunden, ich sah die dunklen Schatten von Liebenden, Standbilder, die sich aneinanderklammerten, sich träge bewegende Doppelmenschen. Ignis mutat res, murmelte ich, doch kein Feuer der Welt würde meine Materie noch verwandeln, ich war bereits verwandelt. Rings um mich wurde noch geschmolzen, gebrannt, da entstanden andere zweiköpfige Wesen, doch ich hatte meinen anderen, so rothaarigen Kopf schon vor so langer Zeit verloren, die weibliche Hälfte von mir war abgebrochen, ich war eine Art Schlacke geworden, ein Überbleibsel.« [Cees Nooteboom: Die folgende Geschichte; übersetzt von Helga von Beuningen; bei Suhrkamp]
Zur Situation: Der Ich-Erzähler ist begeisterter Lateinlehrer, ein großer Fan der Metamorphosen des Ovid, befindet sich in Lissabon und erinnert sich einer Liebschaft. Ignis mutat res ist ein altes, römisches Sprichwort und bedeutet: „Das Feuer verändert die Dinge“.
Was steckt alles in diesem wunderbaren Absatz? Mir geht es besonders um die Bezüge zu den Themengebieten, die den Erzähler ausmachen, also alles Lateinische, Griechische, Mythologische, Philosophische. Fangen wir mit den Doppelmenschen an. Platon ließ in seinen Dialogen andere für sich sprechen. In Symposion lässt er Aristophanes erzählen, dass Menschen früher 4 Arme, 4 Beine und 2 Gesichter hatten, bis Zeus sie aus Rache in Mann und Frau aufgespalten hat. Fortan suchten die Menschen ihre zweite Hälfte und mussten immer unvollständig bleiben. Dieses Bild steht im Zusammenhang mit der Seelenverwandtschaft. Zwei Menschen sind füreinander bestimmt, sie sind zwei Teile des gleichen Wesens. (Kurzer Ausflug: Laut Emanuel Swedenborg werden Liebespaare nach dem Tod im Himmel zu einem einzigen Wesen vereint werden, der dann ein Engel ist.) Auf diese Seelenverwandtschaft beziehungsweise den Verlust eines Teiles seiner selbst spielt der Erzähler hier meiner Meinung nach an. Einerseits versuchen die Liebespaare in der Stadt, zu vervollständigen, was bereits vor ihrer Geburt gespalten worden ist, sich gegenseitig zu komplettieren. Andererseits betont der Erzähler seine eigene Zerrissenheit. Er hat seinen seinen anderen, so rothaarigen Kopf schon vor so langer Zeit verloren, die weibliche Hälfte war von ihm abgebrochen.
Ich habe versucht, eine genauere Herkunft für das Sprichwort ignis mutat res zu finden als „römisches Sprichwort“, aber wurde leider nicht fündig. Die Herkunft solcher Sprüche ist oft unklar, aber zum Glück nicht immer. Nooteboom leitet damit jedenfalls eine Reihe von Ausdrücken, die mit dem Feuer in Zusammenhang stehen, ein. Worauf bezieht er sich hiermit?
Im ersten Gesang des zweiten Buches von Ovids Metamorphosen, der wichtigsten Grundlage unserer Kenntnisse der griechischen Mythologie, einem Werk, das sich, wie der Name sagt, um Verwandlungen dreht, geht es um Phaethon, den Sohn des Sonnengottes Helios. Phaethon besucht Helios eines Tages und nimmt seinem Vater das Versprechen ab, ihm einen Wunsch zu erfüllen, bevor er ihn geäußert hat. Dumme Idee, aber versprochen ist versprochen. Phaethon wünscht sich, eine Spritztour mit dem Sonnenwagen seines Vaters zu machen, mit dem dieser jeden Tag am Himmel entlangfährt – schließlich ist er die Sonne. Helios versucht es ihm erfolglos auszureden. Dann warnt er Phaethon, dass er weder zu hoch fliegen soll, um nicht den Himmel zu verbrennen, noch zu niedrig, um nicht die Erde zu zerstören. Was passiert? Phaethon kann die feuerspeienden Götterpferde vorm Wagen nicht kontrollieren und verbrennt die Welt, verändert sie.
Doch kein Feuer der Welt würde meine Materie noch verwandeln, sagt der Erzähler und greift damit nochmal das Sprichtwort auf. Das Feuer spielt auf die Geschichte von Phaethon an und das Wort verwandeln weist eindeutig auf die Metamorphosen hin. Kein Feuer der Welt kann man in diesem Fall auf das Feuer der Sonne beziehen, wodurch die Verwandlung des Erzählers vollkommen ausgeschlossen wird. Alle Paare, die er beobachtet, sind Einzelmenschen, die sich zu Doppelmenschen verwandeln, die einander finden und dadurch verändern. Aber der Erzähler verändert sich nicht mehr. Seine Sache, seine Lebensmaterie, (res) ist starr geworden. Es kann kein Zusammenführen der beiden Seelenhälften mehr geben. Tatsächlich hatte es sie bereits gegeben, gefolgt von einem weiteren Riss, einer Trennung (welcher Form auch immer).
Die Feuerbegriffe hören hier noch nicht auf. Um ihn herum wird noch geschmolzen, gebrannt. Meine Assoziation sind Ton und Metall. Feuchter Ton wird geformt und dann gebrannt, um fest zu werden. Metall wird erhitzt, um geformt werden zu können, und erkaltet danach in neuer Form. Zwei Wesen werden zu einem. Zum Ton assoziiere ich weiter, dass es mehrere Schöpfungsmythen, auch bei den alten Griechen, gab, nach denen die ersten Menschen aus Lehm geformt worden sind. Ton ist ein Teil der Lehmerde und daher passt es doch wieder. Zum erhitzten und dann erkalteten Metall im Bezug auf die Liebe habe ich eher die Assoziation, dass die Beziehung anfangs heiß ist, es dann zu einer dauerhaften Beziehung (Ehe) kommt und alles erkaltet. Das ist wenig romantisch. Nooteboom schreibt aber intelligent und humorvoll genug, um eine solche Idee einzuschmuggeln. Außerdem würde es einen schönen Rahmen ziehen: Die Beziehung des Erzählers zur Geliebten wurde unterbrochen, bevor sie völlig gefestigt oder komplett erkaltet war, sondern zu einem Zeitpunkt, als alles stimmte, einem Zeitpunkt, an dem es richtig wehtut.
Der Erzähler bezeichnet sich selbst als Schlacke, also als der nutzlose Rest, der bei der Verbrennung von Kohle oder der Verhüttung von Erzen übrig bleibt – Überbleibsel, sagt er ja selbst. Er bleibt im Bild des Feuers, des Schmelzens und der Verwandlungen.
Deshalb wollte ich über diesen Absatz schreiben. Er hat auf so vielen Ebenen etwas zu bieten und ich habe noch nicht einmal vom wunderschönen Bild des Vogels am Anfang – Prophetischer Vogelflug? Verwandlungen des Zeus in Tiergestalten? –, von der poetischen Sprache oder der perfekten Verknüpfung der sprachlichen Bilder und der Figurencharakterisierung gesprochen. So sieht richtig gute Literatur aus. Sprache, Gefühl, Figur, Spielerei und Tiefe bilden eine Einheit, verwandeln sich wie ein Liebespaar zu mehr als der Summe ihrer Einzelteile.