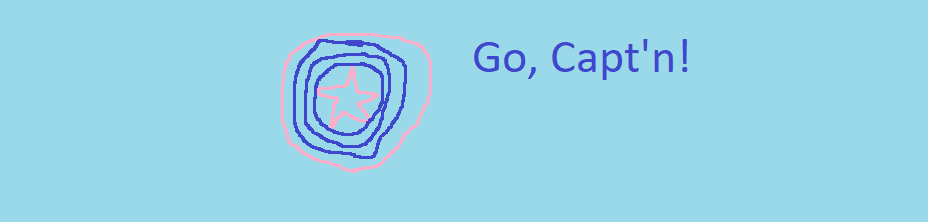Die Mythen der alten Griechen werden schon lange und gern als Ausdruck des kollektiven Unterbewusstseins der Menschen gelesen, als Literatur, die grundsätzlich die alle Menschen verbindenden psychologischen Vorgänge darstellt. Kann man Superheld*innen auch so lesen? (Vermutlich bin ich nicht der Erste, der sich diese Frage stellt, aber ich schreibe jetzt einfach mal drauflos und schaue, wo ich lande.)
Marvel Comics | MCU
Um nicht zu weit auszuholen, beschränke ich mich auf die Figuren von Marvel und dort hauptsächlich auf jene, die dank der Verfilmungen aus dem MCU (Marvel Cinematic Universe) und der Serien der letzten Jahre am bekanntesten sind.
Dualismus: Gut gegen Böse
Im Kern sind Superheld*innen-Geschichten simpel gestrickt: Es gibt eine*n Held*in, die*der für Moral, Mut, das Gute steht, und es gibt eine*n Gegenspieler*in („Bösewicht“), die*der Böses will. In der Umsetzung kommen immer noch Feinheiten hinzu, detailliertere Motivation, eine Backstory. Sonst würde es langweilig werden. Dass das Prinzip des Saubermanns gegen den Schurken nicht mehr wirklich zieht, merkt man daran, dass Figuren der guten Seite, die sich mindestens in der moralischen Grauzone bewegen, immer beliebter werden. Denken wir da an Punisher, Deadpool, Wolverine oder auch den Avenger Hawkeye und seine Gewalteskapaden zu Beginn des Films Avengers: Endgame.
Mit dem geringen Unterhaltungspotenzial einer streng dualistischen Welt (Gut vs. Böse) mussten sich die alten Griechen nicht quälen. Der Dualismus wurde in Europa erst durch das Christentum richtig groß (Gott vs. Teufel) und die hatten woanders her, was uns an dieser Stelle aber nicht weiter beschäftigen soll. Liest man heutzutage die Heldengeschichten von damals, wundert man sich, wer da so als Held bezeichnet wird. Moralisch fragwürdig schien eine Grundvoraussetzung zu sein. Interessanterweise kommen dadurch die Figuren der Mythen und die Mythen an sich näher an die Nacherzählung menschlicher Psychologie heran als die modernen Held*innenstorys. Dennoch finden sich einige Comicfiguren, die Grundsätzliches darzustellen scheinen.
Die Angst vor dem Kontrollverlust: Hulk
Dass der Hulk eine Neuinterpretation von Mr. Hyde aus Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde von Robert Louis Stevenson ist, Bruce Banner also ein Pendant zu Dr. Jekyll, muss man wohl kaum in Frage stellen. Mehrere interessante Faktoren spielen hier im Hintergrund mit. Lassen wir mal den klassistischen Ansatz von Stevenson beiseite. Es geht einerseits um den Wunsch, stark zu sein, die eigene Schwäche zu überwinden, und andererseits, die Angst davor, die Kontrolle zu verlieren (aber nicht im Sinne einer Abgabe der Kontrolle an andere Personen, sondern im Sinne einer Aufgabe der Kontrolle über sich selbst). Beide Antriebe einzeln finden wir häufig, aber kombiniert hauptsächlich im Umgang mit Drogen und besonders Alkohol: Ängste überwinden, Selbstbewusstsein und vermeintliche Stärke spüren, aber dafür ein Stück weit die Selbstbeherrschung aufgeben. Geht man zu weit, macht man sich lächerlich (oder stirbt schlimmstenfalls).
Auf einer anderen Ebene kann man die Transformation Banners in den Hulk auch als Wunsch eines Loslassens der Selbstkontrolle lesen, eines Auslebens von Frustration und Wut. Der Hulk ist immer wütend. Das kennen viele von uns. Aber der Hulk lebt seine Wut aus. Das macht ihn für uns interessant. Er handelt nach seinen dunklen Impulsen und hat dabei die Kraft, nicht gestoppt zu werden. Wer sich einmal richtig hilflos gefühlt hat, wird den Gedanken nachvollziehen können, dass man zwar ausrasten könnte, aber dafür umso mehr bestraft würde oder gar nichts bewirken würde. Wie gerne würde man dann zum Hulk werden und die Ungerechtigkeit, die uns widerfährt, zersmashen.
Die Hoffnung auf den Saubermann: Captain America
Weiter oben habe ich den Dualismus in Superheld*innengeschichten angesprochen. Captain America ist ein gutes Beispiel für den Guten. Er ist sauber, höflich, kämpft für das (vermeintlich) Gute, ist blond, männlich, Christ, Amerikaner, moralisch kompromisslos. Captain America ist eine patriotische Erlöserfigur, und vermutlich ist das der Grund, warum ich ihn nicht mag. Er ist die Verkörperung der Hoffnung, dass einer (ohne *) kommen wird, der uns alle rettet. Der Vergleich mit Jesus liegt gar nicht so fern. Captain America wird als „schwacher“ Mann geboren, nicht reich und nicht kräftig, aber hat ein Ziel, das er verfolgt, wie aus himmlischer Hand werden ihm Kräfte verliehen, er scharrt eine kleine treue Gefolgschaft um sich, mit denen er gegen das Böse kämpft und aus dessen Reihen sich später sein größter Gegner erhebt (der Winter Soldier, der durch sein unfreiwilliges Überlaufen zum Feind dennoch einen Verrat begeht), dann stirbt er und kehrt zurück, um die Menschen zu retten. Man könnte es sogar so lesen, dass die Transformation von Steve Rogers zu Captain America die erste Wiederkehr darstellt und die Rückkehr Captain Americas aus dem Eis die zweite: The Second Coming of Christ. Hier könnte man noch sehr weit interpretieren, aber darum soll es ja nicht gehen. Schließen wir also damit, dass die Figur und Story von Captain America nicht eine Darstellung eines Teils grundmenschlicher Psychologie ist, sondern die Darstellung einer anerzogenen, kombinierten Doktrin christlicher und USA-spezifisch nationalistischer Werte. Yay, Propaganda.
Vorläufiges Fazit
Ich habe mich verrannt. Das ist okay. Das ist Teil des Prozesses. Möglicherweise werde ich in nächster Zeit weitere Ideen zu diesem Blogeintrag hinzufügen, gerade fühlt er sich unvollständig und schief an.
Ähnliche Ideen packe ich manchmal in die Filmbeschreibungen der Blogreihe Thuraus Filmtagebuch. Gerade in den Ausgaben vom Juli und der kommenden für August werden etliche Marvel-Filme besprochen.