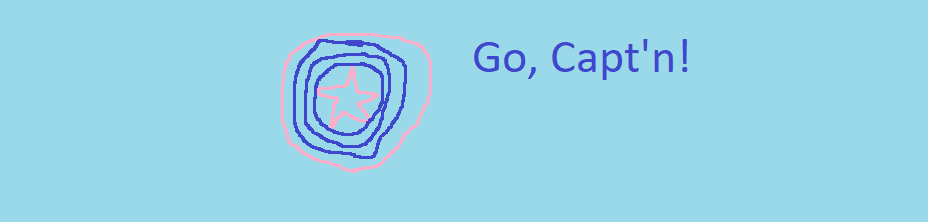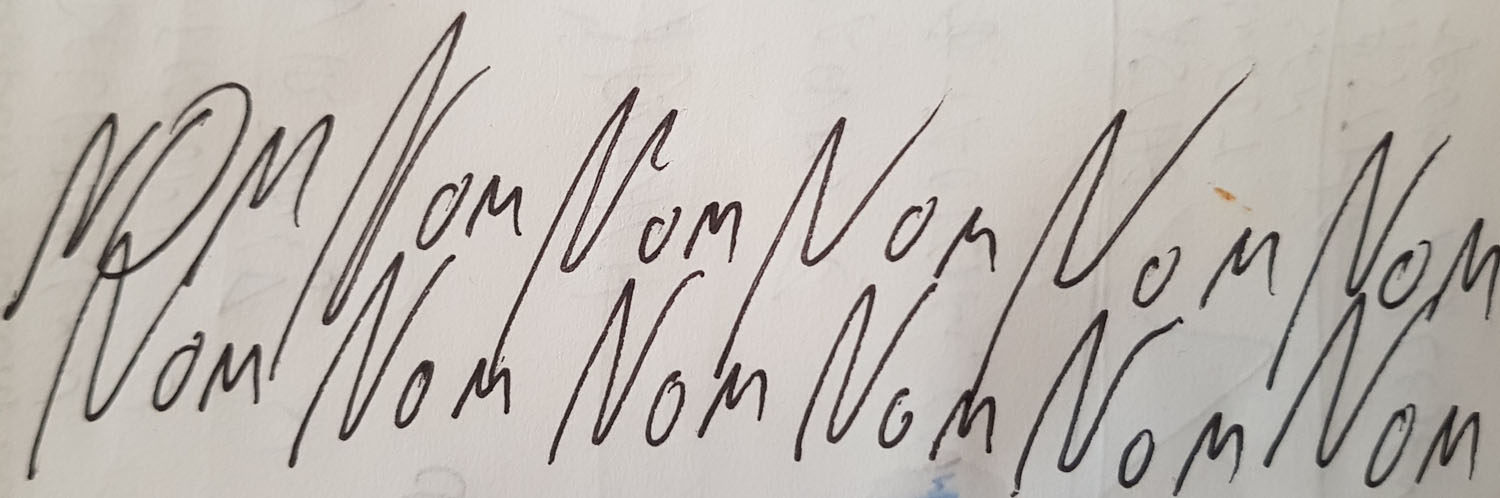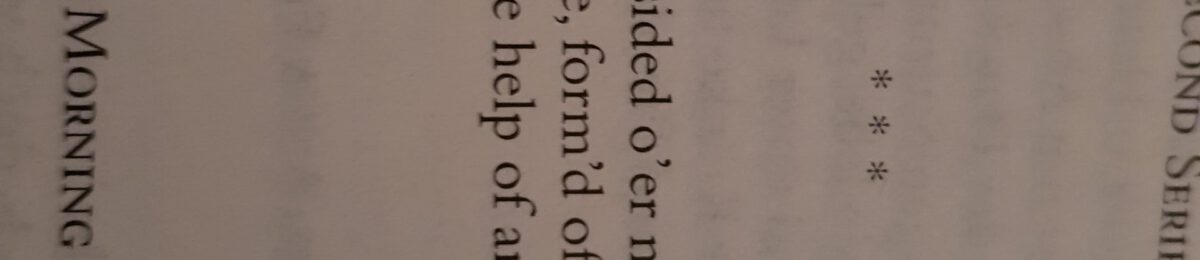Provokation
Die Überschrift dieses Blogeintrags ist absichtlich provokant, wenn auch nicht falsch. Spätestens seit Die Grenzen des Wachstums vom Club of Rome 1972 assoziieren wir „Wachstum“ häufig mit Wirtschaft. Unser Wirtschaftssystem fußt auf ständigem Wachstum, aber nicht unbedingt auf exponentiellem. Es soll hier zwar auch um Wirtschaft gehen, aber nur als Rahmensystem für das, was eigentlich Thema ist: technologische Entwicklung und schließlich Literatur.
Was bedeutet „exponentielles Wachstum“?
Exponentielles Wachstum beschreibt in der Mathematik einen Prozess, in dem eine gegebene Größe in gleichbleibenden Zeitschritten jeweils um den selben Faktor wächst: 2, 4, 8, 16, 32 … Man kann sich diese Art des Wachstums beziehungsweise die Besonderheit dieses Wachstumsprozesses klar machen, indem man sich einen entsprechenden Graphen vorstellt. Während lineares Wachstum in einem Graphen durch eine gerade Linie von links unten nach rechts oben gezeigt wird, sieht exponentielles Wachstum zwar anfangs ähnlich aus, aber erreicht schließlich eine Kurve, nach der die Linie steil nach oben schießt. Diese Kurve und die Veränderung, die sie mit sich bringt, ist hier wichtig.
Ray Kurzweil: Menschheit 2.0
Ray Kurzweil, der sich seit Jahrzehnten auf Mustererkennung spezialisiert hat, Autor, Erfinder und einiges mehr ist, hat in seinem 2005 erschienenen Buch Menschheit 2.0 eine faszinierende Entdeckung beschrieben und diese weitergedacht.
Kurzweil stellte fest, dass sowohl die biologische als auch die technologische Evolution ein exponentielles Wachstum aufweisen, und darüber hinaus, dass beide Kurven zusammengefasst zeigen, dass die technologische Evolution die biologische direkt fortsetzt. Es dauerte Milliarden Jahre, bis Leben entstand, Millionen Jahre, bis sich das Gehirn entwickelt hat, Zigtausende Jahre bis zum Menschen, aber nur gut 100 Jahre vom Telefon zu Breitbandinternet, Smartphones, Hochleistungsrechnern usw.
In Menschheit 2.0 geht es aber nicht um den Blick zurück, sondern um den nach vorn. Kurzweil prophezeit aufgrund seiner Daten das Eintreten der „Singularität“, die ganz grob gesagt, der Übergang von der Kurve im Graphen des exponentiellen Wachstums unserer technologischen Entwicklung hin zum steilen Aufstieg ist. Wir befinden uns laut Kurzweil im letzten Bereich der Übergangsphase. Sobald diese kurze Phase vorbei ist, hätten wir die Fähigkeiten und Möglichkeiten, um unsere Intelligenz mithilfe von Technologie milliardenfach zu vergrößern und würden eine neue Mensch-Maschinen-Gesellschaft bilden.
Hoffnung auf Lösungen, die wir (noch) nicht sehen
Die exponentiell wachsende technologische Entwicklung bezieht sich keineswegs nur auf Computertechnik und Rechenleistung, sondern auch auf Bereiche wie Robotik, Genetik, Nanotechnologie (oder inzwischen noch kleinere Bereiche) und grundsätzlich alle anderen Technologiezweige. Mithilfe der riesigen Entwicklungssprünge könnte man in einem ersten Schritt die Rechenkapazitäten erlangen, um Lösungen für die großen Probleme der Menschheit zu finden, und in einem zweiten Schritt diese Lösungen implementieren. Theoretisch könnten damit Umweltschäden repariert, Krankheiten geheilt, Hunger gestillt und das Todesproblem an sich gelöst werden.
Die Macht zu Gutem und Schlechtem
Man darf natürlich nicht vergessen (und das erwähnt Kurzweil ebenfalls), dass nicht nur die Macht Gutes zu tun exponentiell steigt, sondern auch die Fähigkeiten, Schlechtes zu tun. Eine Technologiestufe, die die Klimakrise schlagartig abwenden oder umkehren könnte, brächte auch Waffentechnik mit sich, die Höllisches anrichten könnte. Wenn wir Krankheiten heilen können, können wir auch neue erschaffen. Entsprechend ist die Übergangsphase, also die Phase, in der wir noch nicht intelligent genug sind, um all unsere kleingeistigen Streitigkeiten, Begierden und unsere Gier zu begreifen und in Schach zu halten, auch eine Zeit großen Risikos. Doch trotz aller Rückschläge, Wirtschaftskrisen, Kriegen, Seuchen und Unmenschlichkeiten im Namen der Wertsteigerung könnte nur noch ein katastrophaler Kollaps die Entwicklung aufhalten. Die Frage ist nur, ob wir schnell genug intelligent und fähig genug werden, um wenigstens die wichtigsten Probleme zu lösen, bevor die Probleme, die wir auf dem Weg dorthin verursacht haben, uns einholen.
Dystopie und Utopie: (Alb)Traum von der Zukunft
1516 erschien der Roman Utopia von Thomas More (oder Thomas Morus). Dieser beschreibt eine ideale Gesellschaft auf einer Insel namens Utopia. Aus heutiger Sicht ist die utopische Gesellschaft nicht besonders ideal: demokratisch, bildungsstrebsam und mit Anspruch auf Gleichheit zwar, aber man verlässt sich auch auf ausländische Söldner für Kriege und errichtet Kolonien, wenn die eigene Bevölkerung zu groß wird. Dennoch war der Einfluss von Utopia groß und fortan wurden alle Werke, die (vermeintlich) ideale (nicht existierende) Gesellschaften beschrieben, als Utopien bezeichnet.
Die Gegenversion einer Utopie, also eine Antiutopie, nennt man Dystopie. Bekannte dystopische Werke sind beispielsweise 1984 von George Orwell oder Brave New World von Aldous Huxley. [Kurzer Ausflug: Aldous Huxley war eine Weile der Französischlehrer von Orwell. Beide wurden später Freunde, nachdem Huxley ihm geschrieben hatte und scherzhaft anmerkte, seine höllische Zukunftsvision sei besser als jene Orwells.]
Dystopische Trends
Obwohl Dystopien traditionell in der nahen Zukunft spielen und Gesellschaften beschreiben, die tatsächlich entstehen könnten, scheint es mir seit Jahren einen Trend hin zu Dystopien mit weniger realistischen Zukunftsvisionen und/oder in entfernterer Zeit liegender Handlung zu geben. Zwei Dinge beschäftigen mich in diesem Zusammenhang:
-
Erfüllen Dystopien noch den ihnen zugrunde liegende Sinn einer Warnung vor aktuellen Entwicklungen, wenn sie wenig oder keinen Bezug mehr zur Jetztzeit herstellen? Eine Dystopie ist im Kern ein zutiefst politisches Werk. Es greift üblicherweise mindestens einen alarmierenden gesellschaftlichen Trend auf und spinnt ihn zum schlimmstmöglichen Endpunkt weiter. So entstand die sedierte und gedanklich unreife Zucht-Menschheit in Brave New World und der sich im Dauerkriegszustand befindliche Überwachungs- und Propagandastaat in 1984. Verkommen Dystopien heute zur Bühne von Freiheitsfantasie vor post-apokalyptischem Hintergrund? Damit würden sie noch immer wichtige Tendenzen in der Gesellschaft aufzeigen, aber nicht mehr ihre traditionelle Rolle erfüllen. Grundsätzlich ist daran nichts auszusetzen, nur frage ich mich, ob ein derart prägnant kritisches Genre wie die Dystopie verwaschen werden sollte und ersetzt werden kann. Kritik ist auch in anderen Genres vertreten, aber Dystopien dienten bisher dieser Kritik zuallererst und erst dann anderen Grundthemen/-tendenzen.
-
Kann man aus der Popularität des Genres eine (wieder) stärker werdende Zukunftsangst schließen? Der Gedanke ist naheliegend. Die Natur ächzt und stirbt, die Klimaveränderungen sind derart drastisch, dass ich sie allein anhand meiner eigenen Erinnerungen problemlos nachvollziehen kann, politische und gesellschaftliche Entwicklungen (Rechtsruck, offener Antifeminismus usw.) bedrohen das bisschen Freiheit, das ohnehin durch ständige Überwachung immer weiter eingeschränkt zu werden scheint. Angst scheint angesichts des Zustands unserer Welt eine angebrachte Reaktion zu sein. Aber hat das etwas mit dem Erfolg von Dystopien zu tun?
Wo sind die Utopien geblieben?
Literatur ist für den Großteil aller Leser*innen ein Mittel zur Unterhaltung. Es hat immer Personen gegeben, die das kritisiert haben und von oben herab auf „Unterhaltungsliteratur“ geschaut haben, aber man kann nicht anders, als sich einzugestehen, dass nur Verkäufe die Literatur langfristig relevant bleiben lassen. Was ich sagen will, ist, dass Dystopien häufiger sind als Utopien, weil sie sich besser verkaufen lassen, und der Grund dafür wiederum ist, dass sie spannender sind. Immer häufiger lese ich zwar die Forderung nach Geschichten mit ruhigen Passagen, die bloß beschreiben (und wohltun), ohne auf Teufel komm raus Spannung zu erzeugen, aber der Schritt zu einem Buch, das zum größten Teil daraus besteht, ist doch noch recht groß, und am Ende ist eine Utopie genau das.
So wie Dystopien (eigentlich?) zutiefst politisch sind, sind es Utopien natürlich auch. Die Wunschgesellschaft der einen Person kann die Höllenvorstellung der anderen sein. Auf der anderen Seite muss man schon eine soziopathische Ader und Hoffnung auf eine Machtposition in der Zukunftshölle haben, wenn man eine richtige Dystopie als utopisch empfindet. Damit möchte ich sagen, dass vom wahrscheinlich geringeren Unterhaltungswert abgesehen, Utopien auch ein größeres Streitpotenzial haben. Man muss nur überlegen, auf welche Ziele manche Personen und Gruppen hinarbeiten, und man hat eine Vorstellung der Utopien, die sie produzieren würden.
Mischformen: Utopische Ideen, aber spannend
Man kann das Star Trek Universum, besonders die Grundlagen der United Federation of Planets, als utopisch lesen, obwohl die Geschichten (von Zeitreise-Plots abgesehen) in der fernen Zukunft spielen. Auch geht natürlich einiges schief, es gibt menschliche Schwäche und Grausamkeit und besonders gibt es die Konfrontation mit weniger utopischen, rückschrittigen oder geradezu dystopischen Gesellschaften: Die misogynen, einzig und allein profitorientierten Ferengi, die kriegerischen Klingonen und die paranoiden, alles überwachenden, von Geheimdiensten gesteuerten Romulaner.
Doch auch in den neuen Filmen und Serien von Star Trek erkennt man einen klaren Trend weg von den positiven, freiheitlichen, urmoralischen Grundzügen der Föderation und damit des Kerns des ganzen Franchises. Verrat, Verfall, korrumpierte Moral, Überwachung, Infiltration überall. Wieso ist das so? Mischformen wie in Star Trek (besonders TNG, Voyager, DS9) konnten und könnten weiterhin dem Marktdruck standhalten, unterhalten und dennoch grundmoralisch und -optimistisch sein.
Was ich an Star Trek immer geliebt habe, war die Gewissheit, dass es trotz des Chaos und der Ungesetzlichkeit des kalten Weltraums immer Ordnung herrschte und die Held*innen niemals ihre moralischen Grundprinzipien verrieten.
Ist Hoffnung unlogisch oder verkauft sie sich nur schlecht?
Schließen wir den Kreis nach dem langen Ausflug: Sollte Ray Kurzweil wenigstens tendenziell Recht behalten (wovon ich ausgehe) und die Menschheit die Schwelle zur Singularität (oder wie auch immer man es nennen möchte) erreichen und überwinden, bevor wir oder unsere Fehler uns selbst oder die Entwicklung stoppen und vernichten, gibt es begründete Hoffnung. Wir werden auf keinen Fall alles retten können, aber wir werden einerseits vieles wiederherstellen und andererseits neuen Schaden verhindern können. Man sollte diesen Funken Hoffnung keinesfalls als Aufruf missverstehen, alles beizubehalten, nicht auf die offensichtlichen Signale der Umwelt und die Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeiten zu reagieren oder die Klimakrise und andere Probleme nicht ernstzunehmen! Wir müssen etwas tun und zwar schnellstmöglich, aber wir können eben auch hoffen.
Warum schlägt sich das nicht in der Literatur nieder? Liegt es außerhalb des gewohnten Denkens von Autor*innen, derart hoffnungsvolle Modelle zu akzeptieren? Sind die Ideen schlicht unbekannt? Sind wir noch immer gefangen in der linearen Betrachtung von Geschichte und technologischer Entwicklung? Oder gehen Versuche hoffnungsvoller, utopischer Literatur einfach unter, weil man sie schlecht verkaufen kann, beziehungsweise Personen mit Einfluss glauben, dass man sie schlecht verkaufen könnte?
Man sollte mich auch hier nicht missverstehen. Ich liebe düstere Werke in jeder Kunstrichtung, aber das heißt nicht, dass man keine Werke veröffentlichen sollte, die Hoffnung auf eine bessere Welt machen. Manchmal sage ich Dinge wie „Kunst sollte wehtun“, aber was tut mehr weh, als zu sehen, wie gut wir es haben könnten, wenn es doch offensichtlich gerade (noch) nicht so ist?