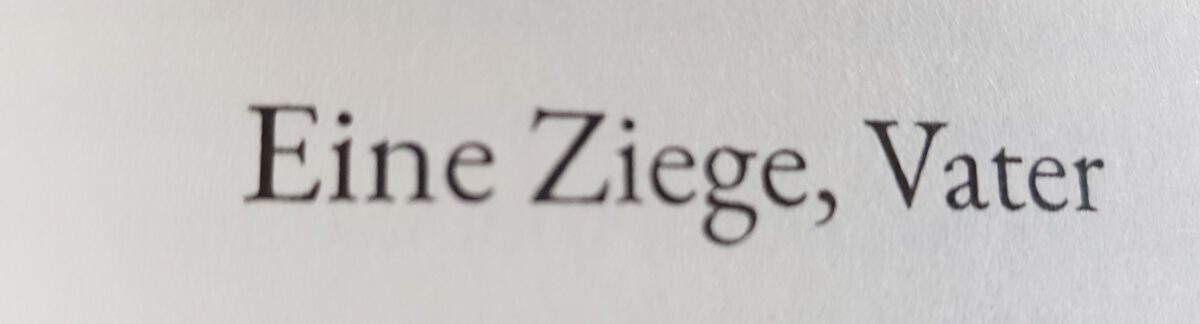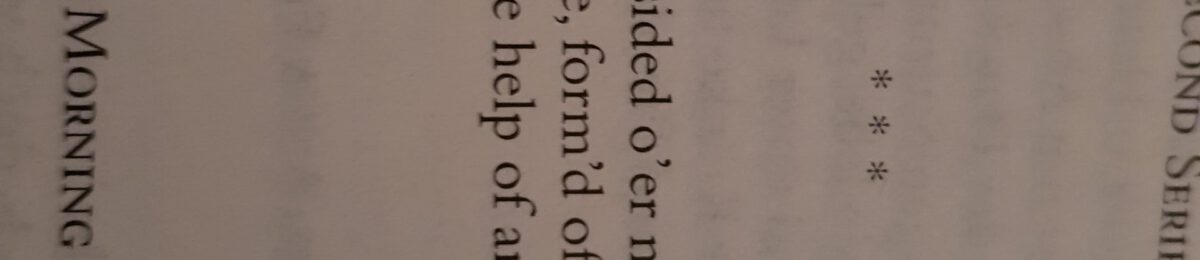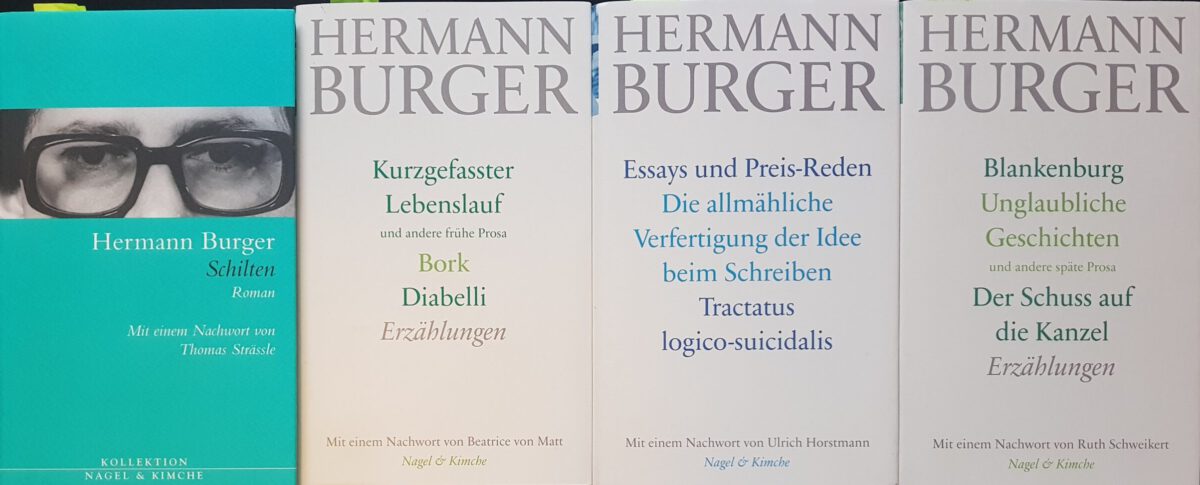Mit dem Blogeintrag über Derrière la Porte von Michael Leuchtenberger habe ich bislang nur einen einzigen Text über Kurzgeschichten und kürzere Erzählungen veröffentlicht. Das sollte sich angesichts der Veröffentlichung meines eigenen Erzählbandes Erschütterungen. Dann Stille. ändern. Es folgt also ein Text über Kurzprosa, die mich bewegt, beeindruckt, inspiriert oder mir nur gefallen hat.
Definitionen
Es gibt Erzählungen, die lang genug sind, um ein eigenes Buch zu ergeben. Hesse hat beispielsweise ein paar gute davon verfasst. Darum soll es hier aber nicht gehen. In diesem Blogeintrag geht es um Texte, die grob ein Maximum von 50 Buchseiten erreichen. Die meisten sind erheblich kürzer.
Die Sortierung wird ebenfalls eher grob gestaltet sein. Etwas Ordnung muss bekanntlich sein. Nehmt alle erwähnten Geschichten gerne als Leseempfehlung. Auf geht es!
Nach dem Krieg
Für Kurzgeschichten und Kurzprosa allgemein war Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg ein fruchtbares Pflaster. Schicksale konnten nicht mehr geteilt werden, Erfahrungen waren nicht mehr erzählbar, nicht so kurz danach. Kurzgeschichten geben Abrisse wieder, stellen sie in den Raum und deuten ein ganzes Schicksal dahinter und drumherum an. Eine gute Kurzgeschichte ist wie ein Schlüsselloch, geradezu winzig, aber es öffnet einen Raum, lässt uns viel mehr entdecken, schenkt uns eine neue Perspektive.
Wolfgang Borchert
Für mich gab und gibt es in deutscher Sprache keine besseren Kurzgeschichten als die wenigen von Wolfgang Borchert geschriebenen. Das Theaterstück Draußen vor der Tür ist ebenfalls eine klare Empfehlung. Der Autor verarbeitet Erfahrungen aus dem Krieg und besonders jene der Heimkehrer, die kein Zuhause mehr haben, in das sie zurückkehren können. Armut, Trauma und das Gefühl, nicht mehr dazu zu gehören, durchziehen das Werk. Leider ist Borchert nur 26 Jahre alt geworden. Sein Tod war ein Verlust für die deutsche Literatur. Da man alle von Borchert verfassten Werke in ein einziges Buch packen kann, sage ich einfach: Kauft euch dieses Buch (in meinem Fall sind es 2 dünne Bücher) und lest es!
Anna Seghers: Der Ausflug der toten Mädchen
Die Erinnerung an einen Schulausflug, verwoben mit dem Wissen, was aus den Mädchen geworden ist im Dritten Reich, was aus den Jungs, die in sie verliebt waren und aus Lehrerinnen und Lehrern geworden ist. Man schwingt von sanften Betrachtungen junger Freund- und Liebschaften zu Deportationen und Verrat, von Herzlichkeit zu Kälte, von Liebe zu Hass, von frischem jugendlichen Leben zu so viel Tod.
Anna Seghers war rechtzeitig die Flucht geglückt und konnte aus dem Exil (Schweiz, Frankreich, schließlich Mexiko) arbeiten. Ein derart naher Blick aus solcher Entfernung ist mehr als faszinierend.
Ingeborg Bachmann
Intelligenz und Gefühl. Das sind die ersten Wörter, die mir einfallen, wenn ich an Bachmanns Werk denke. Ihre Lyrik und Essays (allen voran Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar) sind eben so empfehlenswert wie ihre Kurzprosa. Wieder geht es häufig um die Nachbearbeitung der Zeit des Dritten Reichs. Doch wieder wirkt die Perspektive anders als bei Borchert und Seghers. Wer sich in Sachen Kurzprosa und/oder deutschsprachiger Literatur allgemein (weiter)bilden möchte, kommt um Ingeborg Bachmann nicht herum. Kauft euch einen Sammelband und lest! Lest!
Englischsprachiger Raum
Thematisch, stilistisch und eigentlich in jedweder Hinsicht anders sind die drei Autoren, die mir aus dem englischsprachigen Raum am meisten mitgegeben haben. Zeitlich befinden wir uns mit den dreien einige Jahrzehnte später als bei den drei Autor*innen aus dem vorherigen Segment. Legen wir los!
Hunter S. Thompson
Wenn ich jemandem Hunter S. Thompson erklären will, weise ich auf die Verfilmung von Fear and Loathing in Las Vegas hin. Nicht nur ist die Umsetzung sehr nah an der Buchvorlage dran, Johnny Depp verkörpert Raoul Duke, das Alter Ego von Thompson, perfekt. Depp und Thompson waren Freunde. Vergleicht man Interview-Aufnahmen des Autors mit der Darstellung im Film, ist die Ähnlichkeit geradezu beunruhigend.
Hunter S. Thompson war wahnsinnig, ständig high, lieferte sich Feuergefechte mit Nachbarn, während er ein Interview über den American Dream gab. Seine Kurzprosa besteht weniger aus reiner Fiktion als aus Essays. Die große Haifischjagd wäre ein guter Einstieg. Nie weiß man ganz genau, wie viel Wahrheit in den Berichten steckt, aber man traut ihm alles zu (und einiges ist offensichtlich halluziniert). Thompson begleitet Politiker auf Wahlkampftouren und beschreibt, wie besoffen und zugedröhnt er währenddessen ist. Wer keine Lust auf Drogenstorys hat, ist bei Thompson eindeutig falsch. Seine Texte sind irre Trips, chaotisch, aber dennoch intelligent, voller interessanter und kritischer Beobachtungen und stets auf der Suche nach Wahrheit. Hunter S. Thompson war zuallererst Journalist und versuchte, das Herz der USA zu finden und darzustellen.
Charles Bukowski
Wenig könnte Bukowski egaler sein als das Herz der USA. Wo die nächste Flasche Whiskey herkommt, ist wichtiger. Während Thompson high und aufgedreht ist, ist Bukowski wütend und müde. Er schuftet und trinkt und trinkt noch etwas mehr. Wir machen einen Schritt hinab, was Stimmungsfarbe und Action angeht.
Die Tristesse des hässlichen Säufers, der mit Schlachthausarbeitern und Arbeitslosen abhängt, weil er selbst dazu gehört, vermischt mit Galgenhumor, mag ich. Einerseits glaube ich mich manchmal selbst darin zu sehen und andererseits wirken Bukowskis Werke ehrlich und ungefiltert. Bei aller Liebe zu „großer Kunst“ (was auch immer das sein soll) sind mir Dreck, Ehrlichkeit und Direktheit doch immer lieb gewesen.
Irvine Welsh
Meine erste Assoziation zu Irvine Welsh: Auf dem Rückweg von der Uni, mittags in der S-Bahn habe ich eine seiner Geschichten gelesen und dann abgebrochen, als mir die Tränen gekommen sind. Hätte ich weitergelesen, wäre es peinlich geworden.
Irvine Welsh tut weh. Wenn Bukowski von Thompson aus gesehehen einen Schritt in Richtung Dunkelheit bedeutet, schreiten wir mit Welsh weiter und weiter und weiter. Viele werden von Irvine Welsh eher die Verfilmungen kennen: Trainspotting, Filth usw. Diese Filme sind schon gute Indikatoren, wohin die literarische Reise mit Irvine Welsh geht. Drogensucht, Depression, die tiefsten Abgründe des Menschen, Randexistenzen, Verzweiflung. Dort treibt er sich herum. Manchmal muss Literatur eben doch die Axt für das gefrorene Meer in uns sein, oder? Sie darf jedenfalls.
Anders, brillant
Ein bisschen Weltliteratur fehlt natürlich noch. Ein paar Beispiele werden noch folgen, aber bei weitem nicht alles Erwähnenswerte kann erwähnt werden.
Kafka
Klar. Kafka hat keinen seiner Romane fertiggestellt. Allein schon deshalb muss man ihn im Rahmen von Kurzprosa-Schwärmerei erwähnen. Wer meine Texte kennt, wird vielleicht Grundgefühl, Farbe und Stil ähnlich finden wie bei Kafka, obwohl ein Vergleich für mich schlecht ausfallen würde. Figuren, die suchen, ohne jemals zu finden. Rätsel, die nicht gelöst werden können. Geschichten nicht als Geschichten, sondern als Symbole. Kafka zu empfehlen, ist schon fast kitschig, so selbstverständlich sollte das sein. Also weiter.
Jorge Luis Borges
Einer der Autor*innen mit dem größten Einfluss auf meine Gedankenwelt ist Jorge Luis Borges. Er ist kein Herzensbrecher und Action gibt es auch wenig. Borges liebt Bücher und Ideen. Mit ruhiger Stimme konstruiert er Gedankenpaläste, die auf philosophischen Ideen fußen. Daher wundert es kaum, dass neben den Kurzgeschichten (allen voran die Bände Fiktionen und Das Aleph) Borges besonders für seine Essays berühmt ist. Es ist hochgradig faszinierend, wie er verschiedenste Themen zusammenbringt. Man kommt nicht umhin, immer etwas zu lernen (und meistens nicht das, was man erwartet hätte). Wer Freude hat an gedanklichen Experimenten und Hirnverdrehungen, ist bei Jorge Luis Borges eindeutig richtig. Lest alles von ihm!
Hermann Burger: Diabelli, Prestidigitateur
Der Meister der schwierigen Satzkonstruktionen. Burger hat einige gute Erzählungen geschrieben, aber Diabelli bleibt mein Favorit. Diabelli ist Prestidigitateur (Schnellfingerkünstler, Bühnenmagier) und schreibt seinem Gönner einen Brief. Er erklärt die Tricks und Kniffe der Zauberei, besonders die Technik der Ablenkung, um den Zaubertrick zu vertuschen. Gleichzeitig setzt Burger das Programm perfekt um. Er beschreibt detailliert die Tricks Diabellis, während er sie so ausdrückt und so gut ablenkt, dass man ihnen dennoch kaum oder gar nicht folgen kann. Das Programm ist deutlich, wird sogar erklärt und doch zaubert Burger durch seinen Diabelli im Kopf der Leser*innen herum, dass einem schwindlig wird.
Noch mehr
Es gibt von Dürrenmatt eine Sammlung mit nicht fertiggestellten Stoffen und Gedanken dazu unter dem Titel Labyrinth: Stoffe I-III. Darin findet sich die Geschichte Der Winterkrieg in Tibet. Ich habe eine sehr ähnliche Geschichte einmal geträumt, aber weiß nicht mehr, ob es vor oder nach der Lektüre gewesen ist. Borges hätte das gefallen. Hat der Traum die Lektüre beeinflusst oder die Lektüre den Traum? Jedenfalls denke ich immer mal wieder an die Geschichte.
Daniel Kehlmann ist Romancier. Er kann auch Essays und Kurzprosa schreiben, aber sein Talent liegt eher in längerer Prosa. Im Rahmen der Lektüre sämtlicher Werke von Kehlmann (ja, ich hatte so eine Phase) habe ich auch seine Erzählungen gelesen. Manche nahmen mich gefangen. In der Zeit sogar genug, um Kehlmann im Romanmanuskript zu erwähnen. Das ist das gleiche Manuskript, das schließlich zur Erzählung Der Spinner in Erschütterungen. Dann Stille. geworden ist. Ich habe den Part nicht gestrichen, vielleicht aus Nostalgie. Deshalb ist er hier erwähnt.
Fazit?
Kurzprosa hat den Vorzug, dass sie kurz ist, und den Nachteil, dass sie kurz ist. Da Kurzprosa dennoch nicht weniger tief sein darf als Romane, muss getrickst werden. Der Trick besteht darin, dass eine größere Leistung von den Leser*innen erbracht und dass diese Leistung herausgekitzelt werden muss, ohne dass es bemerkt wird. Man beschreibt einen Baum und lässt einen Wald im Kopf entstehen. Man beschreibt eine einzelne Lebensszene und lässt ein Schicksal im Kopf erwachsen. Das ist die große Kunst von Kurzgeschichten. Autor*innen wie Borchert benötigen dafür nur eine einzige Buchseite. Das wird niemals aufhören, mich zu faszinieren.
Auch etwas längere Kurzprosa muss auf ähnliche Weise tricksen, Andeutungen verbauen, mit Assoziationen arbeiten wie Lyrik und Gefühl mit dem richtigen Ausdruck verbinden, um mehr darzustellen als beschrieben wird. Ob mir das gelungen ist, weiß ich nicht.