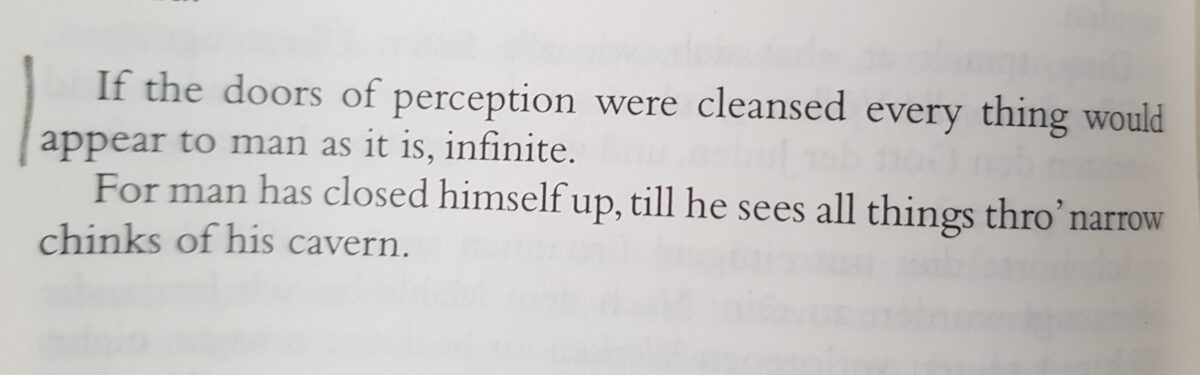Meine Sprechstimme ist nicht meine Schreibstimme, die Schreibstimme nicht immer die Gleiche, meine Vorlesestimme härter als die Sprechstimme, obwohl sich diese immer mal wieder ändert.
In diesem Blogeintrag soll es um Stimmen gehen und um Wörter: geschriebene und gesprochene.
Stimmung und Stimmen
Aufgeregt spreche ich schnell, hektisch, wie auf Speed. Verängstigt bin ich leise, die Stimme ist schwächer noch als bei Müdigkeit. Spreche ich am Telefon mit Ämtern, klinge ich anders als am Telefon mit Freund*innen, bei diesen jeweils unterschiedlich, und persönlich nochmal anders als am Telefon. Viele Menschen bemerken es nicht, aber man kann einiges an ihren Stimmen ablesen, besonders wenn man sie besser kennt.
Das Gleiche gilt für Schreibstimmen. Wir machen es oft unbewusst, passen unseren Stil an die Begebenheiten des Textes an, werden schneller an spannenden Stellen, werden langsamer in ruhigen Sequenzen. Man entwickelt ein Gespür dafür, vermutlich verstärkt durch gute Lektüre, vielleicht aber auch einfach aus dem Alltag heraus. Erzählpraktiken sind Alltagskommunikationspraktiken. Zwar erzählen wir literarisch eine Geschichte anders als im persönlichen Gespräch, aber dennoch wenden wir auch dort Erzähltechniken an. Wir nutzen Spannung erzeugende Wörter wie „plötzlich“, untermalen unsere Worte mit Gestik und Mimik (was wir beim Schreiben kopieren oder umgehen), setzen seltener ab an spannenden Stellen (schriftstellerisch würde man beispielsweise weniger Unterbrechungen durch Punkte einfügen, sondern längere, hastige Sätze nutzen) oder setzen absichtlich eine Pause vor einem Höhepunkt, um die Spannung weiter zu heben und zu halten.
Gesang und Musik in der Literatur
Es gab mehr als eine Person, die Lyrik mit Musik verglichen hat. Der Rhythmus macht’s. Keine Sorge, ich werde jetzt keinen Vortrag über Metrik und all das hier hinklatschen, sondern nur darauf hinweisen, dass der Rhythmus, mit dem wir etwas persönlich erzählen, sich in der Lyrik widerspiegelt (wenn wir es wollen). In meinem Fall erinnert der Rhythmus der Gedichte eher an den Rhythmus meines Gedankenstroms. Ich spreche sortierter, weil ich schweige, bis ich zusammenhabe, was ich sagen möchte. Aber ich denke sprunghaft, chaotisch, auf mehreren Ebenen zeitgleich. Das gilt zumindest für die Zeiten, in denen ich emotional engagiert und nicht völlig entspannt bin. Gedichte wiederum würde ich nicht schreiben, wäre ich völlig entspannt (was ich ohnehin im Grunde niemals bin). Manchmal durchbreche ich lyrisch meinen Gedankenstrom absichtlich, zerteile ihn, leite ihn um. Auch das ist meine literarische Stimme: Sie widerspricht all meinen anderen Stimmen, wenn sie es will oder muss oder beides, also: soll.
Dass die Ursprünge der Lyrik in frei vorgetragenen Gesängen liegen, wundert wohl niemanden. Die Verbindung zur Musik ist deutlich. Doch schwieriger ist es, Musik in Prosa umzusetzen oder zu übersetzen. Manche Autor*innen machten und machen es sich einfach, indem sie es für die Leser*innen schwierig machen. Sie werfen mit Fachbegriffen aus der Musik um sich, mit denen manche Leser*innen nichts anfangen können. Sie nennen Songs und Stücke, aber bleiben dabei bei einer reinen Nennung, die keineswegs das Gefühl auslöst, das ebendieser Song oder ebendieses Stück selbst auslösen würde. Wie also Musik beschreiben? Schwierige Frage. Ich kann es nicht (oder nicht gut). Die beste Umsetzung beschriebener Musik habe ich bisher bei Proust gefunden in In Swanns Welt, dem ersten Buch der Reihe Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. (Über dieses erste Buch hinaus habe ich es übrigens nie geschafft.)
Geschrei und wirklich lautes Schreiben
Manchmal muss man laut werden, manchmal will man es bloß. Man könnte eine laute Erzählstimme nun mit einer Vielzahl von (falsch gesetzten?) Ausrufezeichen zu erreichen versuchen. Aber das sieht nun einmal behämmert (und alles andere als gekonnt) aus!!! Auch CAPSLOCK ist nicht wirklich eine Option. Doch wann und warum sollte man überhaupt literarisch schreien wollen? Eine erste Antwort wäre recht wörtlich in Dialogen zu finden: eine Figur schreit. Etwas abgehobener fielen mir Lyrik und andere Kurzformen ein, die allgemein etwas freier sind und häufig Gefühle direkter übertragen beziehungsweise direkt von diesen handeln. Ein Gedicht ist ein Schrei, wenn di*er Autor*in es so will oder di*er Leser*in es so versteht.
Im Falle von Dialogen wäre die simpelste Lösung, das Geschrei in Form einer passenden Inquit-Formel zu verdeutlichen: „F*** dich!, schrie sie.“ Oder man lässt di*en Dialogspartner*in etwas Entsprechendes antworten („schrei doch nicht so“). Doch an dieser Stelle könnte man wenigstens die Erregung in der Stimme der sprechenden Figur mit anderen Mitteln darstellen. Ist man wütend, spricht man Sätze oft nicht zu ende, verhaspelt sich, nutzt Kraftausdrücke und Beleidigungen (je nach Situation) und gestikuliert bei alledem. Geschrei ist die Grenze zwischen verbaler Kommunikation und einer Handlung. Näher kommt eine Stimme nicht mehr an eine Tat heran. Gesten kann man in Einschüben beschreiben. Hier kann man stark den Leser*inneneindruck einer Figur beeinflussen, indem man die Gesten gerade in hocherregten Zuständen neutral, ernst, weniger ernst oder sogar lächerlich beschreibt (bewegen, schlagen, wedeln, fuchteln etc.).
Zeit mich zu korrigieren: in stilistisch im Grunde völlig freien Texten wie Gedichten kann man sehr wohl Capslock verwenden oder beispielsweise (nicht gerade für Geschrei, aber generell) die zum Meme gewordene abwechselnde Groß- und KleinScHrEiBuNg, wobei man bei letzterem die Vorkenntnisse der Leser*innen und deren Verständnis und Assoziationen miteinbeziehen muss. Auch damit imitiert man im Grunde einen Sprechakt und ein Augenrollen zugleich.
Macht, was ihr wollt! Die Kunst ist frei. Ich persönlich bin übrigens ein Fan von sparsam aber gezielt gesetzten Kraftausdrücken in Gedichten.
Lesungen & Angst
Wie in der Einleitung erwähnt, klinge ich Gedichte vorlesend völlig anders als im Alltag sprechend. Aus mir nicht wirklich ersichtlichen Gründen, außer vielleicht der deutlicheren Betonung der einzelnen Silben, klinge ich bei Lesungen wie ein Radiosprecher aus den 1950er Jahren, aber mit einer verschmitzten, moderneren Note, weil meine Texte diese erfordern. Das ist natürlich kein Problem, nur eine Feststellung. Problematischer und mit Stimmung und Stimme zusammenhängend ist meine Angst vor Lesungen. Ich spreche nicht gern vor Menschen, spreche manchmal generell nicht gern, und werde leise, sobald ich bemerke, dass mehr als eine Person zuhört.
Warum erzähle ich das? Möchte ich authentischer wirken? Vielleicht. Vielleicht möchte ich mich aber auch pushen, wenn ich jetzt nachtrage, was ich zu tun gedenke, um in Zukunft Lesungen halten zu können:
- Schritt 1: Texte laut vorlesen, wenn ich allein bin.
- Schritt 2: Texte laut vorlesen und mich dabei filmen.
- Schritt 3: Aufgenommene Lesungen, die geglückt sind, hochladen und teilen.
- Schritt 4: Online Lesungen zu Zeiten, in denen wahrscheinlich niemand zusehen wird.
- Schritt 5: Lesung (online oder live) vor Freund*innen.
- Schritt 6: Online Lesungen halten zu Zeiten, in denen potenziell Leute zusehen könnten.
- Schritt 7: Schritt 6, aber mit Vorankündigung, oder: eine richtige Online-Lesung.
- Schritt 8: Live-Lesung.
Einzelne Schritte könnte man austauschen oder überspringen, aber grundsätzlich ist das mein hier mein Plan hin zur ersten richtigen Lesung. Da ich bereits mehrfach Angebote bekommen habe, Lesungen zu halten, sollte ich langsam mal loslegen.