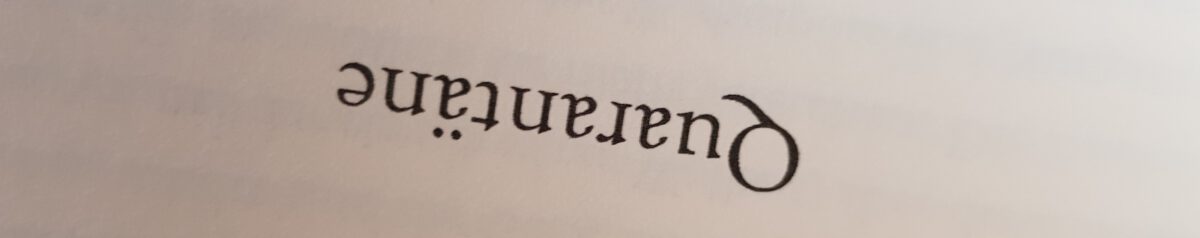Content Notes: Krankheit, Psychose, Angst
Die Welt ist eine Peststadt. Okay, das ist etwas hart. Während ich das hier schreibe und vermutlich noch lange Zeit, nachdem es veröffentlicht sein wird, existiert das Covid19-Virus. Daher wird jede*r davon ausgehen, dass die Geschichte Quarantäne in Erschütterungen. Dann Stille. etwas mit Corona zu tun hat, allein weil der Text 2020 veröffentlicht worden ist. Dem ist aber nicht so. Im Folgenden werde ich auf die Entstehung eingehen. Ohne Spoiler wird das nicht möglich sein. Ihr wurdet gewarnt.
Entstehungszeit
Für die Interpretation mancher Texte sollte man wissen, wann sie veröffentlicht und wann sie verfasst worden sind. Stichwort: Historischer Kontext. Beispielsweise würde man die Wortwahl einiger älterer Werke heutzutage mindestens diskutieren, wenn man sie nicht strikt ablehnen würde. Eine literarische Verherrlichung des Krieges oder der Nation wäre nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland unangebracht gewesen. Günter Grass und andere stellten sogar die viel diskutierte Frage, ob man nach Auschwitz überhaupt noch (Gedichte) schreiben dürfe.
Es gibt historische Einschnitte, die im Nachhinein den Blick auf Ideen verändern. Schaut man sich nach 9/11 den Film Rambo III an, so wird man stutzen, sollte man ihn noch nicht gekannt haben. Rambo, der amerikanische Soldatenheld (und leider ohne den kritischen Blick des 1. Teils), kämpft gemeinsam mit den Mudschahedin gegen die Sowjets. Wenn der Feind auch langsam wieder in Mode kommen mag, wirken die Verbündeten, die ebenfalls als Helden porträtiert werden und aus deren Reihen al-Qaida erwachsen ist, doch reichlich seltsam.
Große Ereignisse mit globaler Implikation verändern unseren Blick auf die Welt, auch nachträglich. Die Corona-Pandemie ist eindeutig ein solches Ereignis. Dass meine Geschichte mit der Pandemie im Hinterkopf gelesen werden wird, ist mir bewusst.
Bessere Zeiten
Die Erzählung Quarantäne ist vor der Pandemie entstanden, genauer am 28. Dezember 2019. Am 31. Dezember 2019 wurde der erste Fall (noch ohne den heute gängigen Namen) offiziell bestätigt. Ihr erinnert euch? Das war die Zeit, in der das Virus noch weit weg war. Danach folgte die Zeit, in der es sich ausbreitete (Frankreich, Italien usw.). Auch danach hieß es noch überall, dass es wie eine Grippe sei. Heute wissen wir es besser, und wer es nicht besser weiß, will es nur nicht besser wissen.
Hätte ich geahnt, was nur wenige Monate später passieren würde, hätte ich die Idee des Verrückten, der sich vor einer eingebildeten Seuche versteckt, wieder verworfen. Aber ich bin schlecht im Wegwerfen und gehe davon aus, dass man der Geschichte anmerkt, dass sie nicht als Kommentar zu Corona verstanden werden will.
Einbildung
Der Ich-Erzähler in Quarantäne ist geisteskrank. Das ist unschwer zu erkennen an den Stimmen, die er hört, und den vermeintlichen Zeichen, die er sieht. Als Laie würde ich eine paranoide Schizophrenie diagnostizieren. Aber (und das will ich betonen): Ich habe wenig Ahnung davon. Mir geht es um andere Dinge.
Wo die einen „Wacht auf!“ rufen, während sie im indoktrinierten Verschwörungsschlummer dösen, und die anderen kopfschüttelnd auf die Ignoranten blicken, fallen Wahn-Diagnosen gerne mal als Vorwurf oder Beleidigung. Das ist einfach falsch. Auch werfen sich alle Seiten gegenseitig Indoktrination vor, wo es doch wenigstens auf einer Seite schlichte Sozialisation ist. Das kratzt schon mehr an meinem Thema. Was die einen Fakt nennen, ist für andere Unfug, und – und das macht wohl so wütend – auch umgekehrt. Es geht hier um …
Perspektiven.
Wie sehen andere die Welt? Das frage ich mich manchmal. Wie kann man sich in der eigenen Freiheit eingeschränkt fühlen, nur weil man ein Stück Stoff tragen soll, das das eigene Leben und das anderer schützen soll? Solche Dinge frage ich mich.
Quarantäne sollte als Geschichte eine besondere Perspektive auf die Welt zeigen, die die meisten von uns niemals einnehmen werden. Dachte ich. Seit Entstehung der Erzählung haben viele eine noch aggressivere und fremdgefährdendere Sicht auf die Welt angenommen als der Protagonist. Ich wünschte, ich könnte so viel Ignoranz irgendwie verständlicher machen. Aber das übersteigt meine Fähigkeiten.
Der Ich-Erzähler glaubt nicht mehr an Fakten, sondern an Verschwörungen, nicht mehr Ärzt*innen, sondern ominösen Zeichen. Als Konsequenz zieht er sich zurück. Wie angenehm für alle anderen, oder? Das muss doch die Reaktion heutzutage sein. Er rennt nicht zu einer Grundschule, um unter den Masken von Schulkindern CO2-Werte zu messen. Er isoliert sich und tut sich damit etwas an, obwohl er nicht müsste. Das ist die Macht von Ideen, ob sie nun in einem kranken Gehirn entstehen oder in das von Indoktrinierten gesetzt werden. (Kurzer Zwischengedanke: Sind Gruppenillusionen grundsätzlich aggressiverer Natur als Einzelillusionen?)
Angst
Angst ist der treibende Faktor der Geschichte. Der Ich-Erzähler mag Stimmen hören und Zeichen sehen, aber was dahintersteckt, ist immer Angst. Er fürchtet sich vor Ansteckungen. Und selbst das mag nur eine vorgeschobene Angst sein, hinter der sich noch mehr versteckt. Denn hinter den meisten Ängsten steckt noch etwas anderes. Während der Pandemie fürchtet man sich absolut zu recht vor Ansteckung, aber der Protagonist meiner Geschichte fürchtet sich vielleicht mehr vor Menschen als vor Keimen, mehr vor Intimität und Berührung als vor Krankheit, mehr vor eigener Schwäche als vor fremden Viren. Vielleicht hält er sich selbst und sein Leben unter Kontrolle durch die Angst, um sich nicht den eigenen Dämonen stellen zu müssen.
Dass man sich nach der Lektüre von Quarantäne nicht nur über Perspektiven Gedanken macht, die man nicht kennt oder nicht versteht, aber die dennoch respektiert werden sollten, sondern auch darüber, wie Angst die eigene Perspektive auf die Welt verändern, verzerren kann. Daraus könnte vielleicht die Erkenntnis entwickelt werden, dass wir vorsichtiger sein sollten mit dem Verteilen von Urteilen und der Erschaffung von Ängsten. Ist der folgende Sprung zu weit? Drohungen und Angst mögen die Erziehung kurzfristig einfacher machen, aber sind niemals ein guter Start ins Leben.
Der Diskussion wegen
Warum zum faulen Apfel veröffentliche ich eine Geschichte, die man wahrscheinlich anders liest als sie ursprünglich gemeint war? Das schreit ja geradezu nach Missverständnissen. Eben deswegen. Denkansätze, Denkanregungen, Assoziationen. Das ist mein Ding. Quarantäne ist als Denkansatz konzipiert und als Perspektivwechsel. Tut mir einen Gefallen und nutzt beides! Denken und Perspektivwechsel helfen gegen Ignoranz.