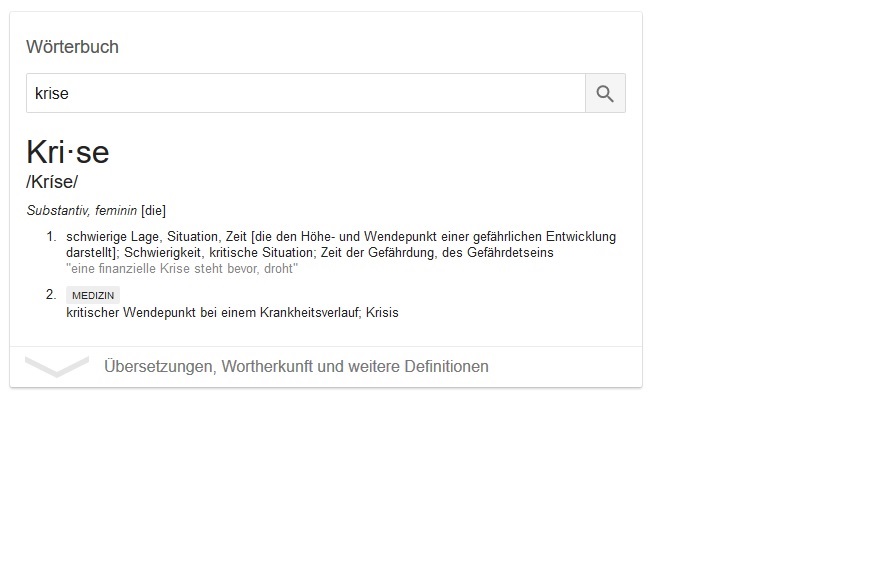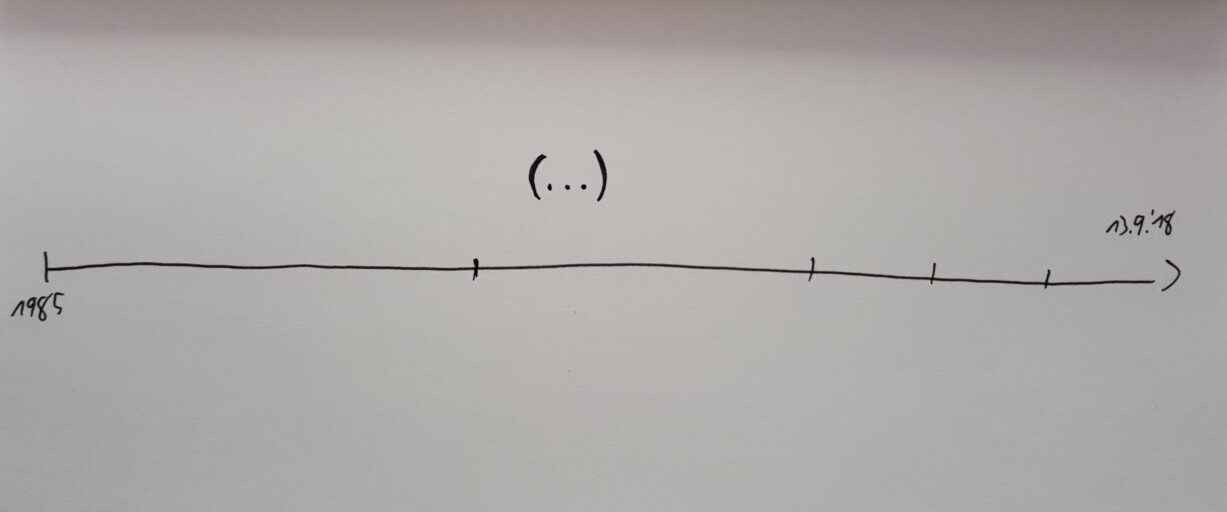Dieser Eintrag handelt von verschiedenen Krisen rund um das Schreiben und darum, wie ich sie für mich löse oder zu lösen versuche.
Tabula Rasa & Horror Vacui
Das weiße, unbeschriebene Blatt, das sich vehement weigert, gefüllt zu werden.
Ob es nun die erste Seite eines neuen Projektes sein soll oder irgendeine Seite sehr viel tiefer im Arbeitsgeschehen, jeder Autor fürchtet sich wohl davor.
Fangen wir mit dem ersten Problem an. Wollen mir keine neuen Ideen kommen, was, ehrlich gesagt, sehr selten ist, ich aber unbedingt etwas schreiben möchte, gehe ich zunächst spazieren.
Das gibt neue Eindrücke und lässt das Gehirn ohne Druck arbeiten; hilft übrigens auch bei fortgeschrittenen Projekten und Problemen bestens.
Auf jeden Fall sollte man als Autor über eine ausreichende Fähigkeit zur Selbstreflexion verfügen und mit der Zeit wissen, was grundsätzlich inspirierend wirkt – Musik, Kunst, Passagen des Lieblingsautors etc. Auch diese Quellen aufzusuchen ist einen Versuch wert.
Eine der besten Methoden ist allerdings einfach nach bereits vorhandenen Ideen (aus dem eigenen Vorrat) zu suchen. Tage- und Notizbücher kann man gut durchstöbern, stößt möglicherweise auf fertige Plots, die ungenutzt verstauben, oder auf Erinnerungen an Liebschaften, Verluste, Freuden, die etwas auslösen. Das ist einer der vielen Gründe, warum man sämtliche Ideen notieren sollte, auch wenn man sie im Augenblick nicht zu brauchen meint.
Häufiger ist das Problem des Steckenbleibens in einer Geschichte – auch trotz Vorbereitung und Planung oder währenddessen. Natürlich kann man die gleichen Schritte (wörtlich und übertragen) unternehmen wie auch bei totaler Ideenlosigkeit. Doch mir hilft es am allerbesten, wenn ich mich den Problemen direkt stelle und mit meinen Fragen arbeite. Ich schreibe auf, weswegen ich nicht schreiben kann, was mich festhält und woran es liegen könnte. Die Fragen „Wie soll es weitergehen?“ oder „Warum sollte die Figur das tun?“ oder andere notiere ich mir und spekuliere regellos, aber ebenfalls in geschriebener Form (Stichpunkte oder ausformuliert). Üblicherweise arbeitet mein Gehirn im Hintergrund an den Antworten, die im Vordergrund gefordert werden. Während ich also die Fragen aufschreibe, beantworte ich sie mir bereits. Am Ende wundere ich mich manchmal, warum ich dann all die Probleme notiert habe, doch ohne diesen gesamten Ablauf wäre ich nicht voran gekommen.
Eine weitere, verspieltere Methode habe ich irgendwann für mich entdeckt: meine Wörterbuch-App hat eine „Zufallswort“-Funktion, welche ich dafür nutze. Das auftauchende Wort wird einfach irgendwie mit der Geschichte oder der Figur, um die es gerade geht, verknüpft. Würde eine Figur dieses Wort benutzen? Könnte man damit etwas oder jemanden beschreiben? Auf diese Weise erhält man etwas andere Perspektiven auf die eigene Story und kommt auf neue Ideen. Das funktioniert allerdings vermutlich nicht, wenn man unter Zeitdruck steht.
Gestern hat mich dieses Spielchen übrigens zu einer Kurzgeschichte inspiriert. Offenbar funktioniert es also auch bei der weiter oben stehenden Problematik.
Was treibe ich hier eigentlich? – Zweifel am Werk
Lese ich die Werke großartiger Autoren, die es längst geschafft haben, mache ich den Fehler und vergleiche mich mit ihnen. Das kann auch passieren mit Schriftstellern, die zwar veröffentlicht sind, aber ohne (in meinen Augen) eine Rechtfertigung dafür abzuliefern. In beiden Fällen kommen Zweifel an den eigenen Fähigkeiten, Ideen und Werken auf.
Gibt es dafür eine Lösung? Nicht wirklich.
Als Autor bin ich narzisstisch genug, um davon überzeugt zu sein, dass meine Werke notwendig sind. Werden sie nicht veröffentlicht, ist das ein Fehler im System und keiner meinerseits.
Selbst wenn ich nicht von meinem Werk überzeugt wäre, würde das auch nichts ändern. „Kunst kommt nicht von Können, sondern von Müssen“ sagte Arnold Schönberg. Da kann man wenig ergänzen. Ich schreibe nicht, weil ich es mag oder gut kann, sondern weil ich es muss. Da ich es schon lange muss, habe ich es häufig getan und kann es daher, was mir Erfolgserlebnisse beschert, weswegen ich es mag.
Was tun, wenn man nichts tut? – Motivationsproblematik
Nach den Worten eben muss schon die Überschrift paradox klingen. Allerdings gehe ich immer wieder durch Phasen, in denen ich nicht schreibe – und auch sonst wenig schaffe. Dann bin ich halbwegs depressiv – „halbwegs“, da dies kein Urteil von professioneller Seite ist – unzufrieden, lenke mich mit Nichtigkeiten (Netflix usw.) ab und bin insgesamt sehr kraftlos.
Hier sprechen wir von einem anderen Gegner als dem Zweifel weiter oben.
Meiner Erfahrung nach kann man es in diesen Zeiten einfach nur versuchen, auch wenn das Scheitern meist vorprogrammiert ist. So lange und häufig den inneren Schweinehund zum Kampf stellen, bis man den Sieg davonträgt.
Es gibt immer einen richtigen Zeitpunkt, um wieder herauszufinden aus der Dunkelheit. Einerseits gibt das Hoffnung, bevor der Moment da ist. Andererseits scheint es, wenn er dann gekommen ist, keineswegs zwecklos, ihn zu ergreifen. Das wiederum muss sein. Absacken in sein persönliches Gefühlsloch kann man jederzeit wieder, also sollten die Pausen unbedingt genutzt werden.
Manchmal sitze ich in solchen Zeiten da, schaue einen Film, der mich nicht interessiert, spiele gelangweilt am Handy und bin tief unzufrieden. Warum? Weil ich nicht tue, was ich tun sollte, was mich zu tun drängt. Wie vorher gesagt: ich muss schreiben. Dieser Drang, diese Kraft, ist immer da. Auf der anderen Seite steht ein selbstzerstörerischer Trieb, der sich eben gelegentlich wie eine Mauer verhält und totalen Stillstand fordert. Die bekannte Superman-Frage: Was geschieht, wenn ein unbewegliches Objekt von einer unaufhaltbaren Kraft getroffen wird?
Es kommt zu herrlichen Ausbrüchen von Kraft.
Ich baue die Mauer und die Explosionen in meine Geschichten ein.
Nein, ich baue aus daraus meine Geschichten.