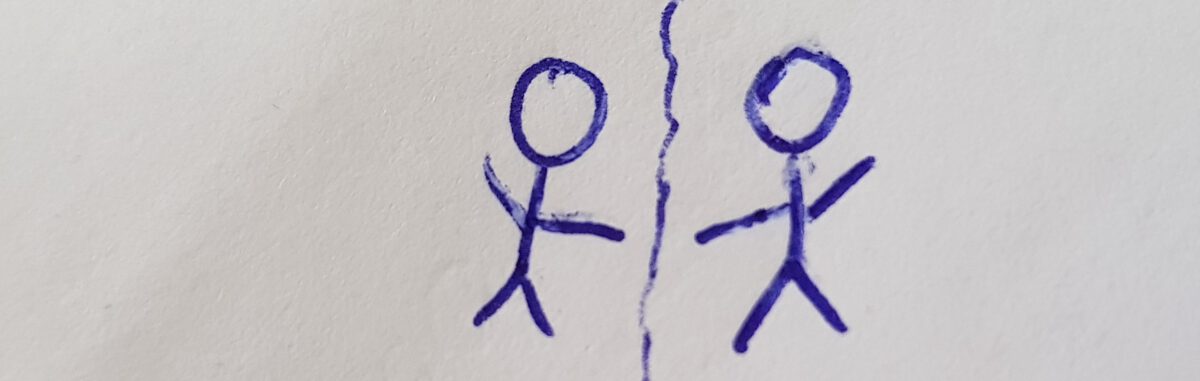Figuren interessant und stimmig zu beschreiben, ist bereits schwierig. Ich möchte aber einen Schritt weitergehen und über Figurenbeschreibungen durch andere Figuren nachdenken.
In Die folgende Geschichte von Cees Nooteboom lässt der Autor den Ich-Erzähler, einen Altphilologen, über einen Mann, den Ehemann seiner Geliebten, sprechen. Er beschreibt ihn als eine(r) Art Riese aus Kalbfleisch, glatzköpfig, mit einem ewig grinsenden Gesicht, als würde er ständig Kekse anbieten. Die beschriebene Person ist außerdem Lehrer für Niederländisch – anbei bemerkt sei, dass die Geschichte im Original Niederländisch ist – und schreibt Gedichte. Der Ich-Erzähler kommentiert dazu, dass sein Konkurrent im Unterricht den Schülern bloß strukturiert beibringe, was sie ohnehin von jüngster Kindheit an können, und endet mit den Worten: … aber auszusehen wie ein schlecht gebratenes Kotelett und von Poesie zu sprechen, das geht zu weit.
Wir haben hier eindeutig keine sachlichen Beschreibungen. Der Beschriebene ist verheiratet und hat Affairen (oder „Affären“, wie man es leider heute schreibt), also ist der giftige Ton möglicherweise angebracht, wenigstens aber verständlich. Gleichzeitig wird er nicht auf jede*n dermaßen unattraktiv wirken, wie er vom Erzähler, der ja sein Konkurrent ist, gezeichnet wird. Was können wir über den Ich-Erzähler durch die wenigen Kommentare lernen?
Zunächst einmal, dass man ihm, wie eigentlich allen Ich-Erzählern, nicht trauen sollte. Ich-Erzähler sind Teil der Geschichte, sind selbst Figuren, haben Gedanken, Gefühle und eine Agenda. Sie stehen keinesfalls außerhalb des Geschehens und sind daher nicht neutral. Ihre Wertungen und ihre Beteiligung machen sie suspekt. Man sollte Geschichten mit derartigen Erzählern immer hinterfragen: Stimmt es, was uns von der Erzählinstanz aufgetischt wird? Was ändert sich, wenn wir uns gegen die Ansichten der Erzählinstanz entscheiden? Solche und andere Fragen sind spannend. Natürlich möchte man als Leser*in in eine neue Rolle schlüpfen und die Welt durch fremde Augen sehen, aber man sollte niemals vergessen, dass hinter diesen fremden Augen die gleichen Hinterhältigkeiten stecken (können) wie hinter den eigenen Augen. Gerade die zeitweise Übernahme anderer Perspektiven mithilfe der Literatur sollte uns lehren, Abstand gewinnen zu können und objektiv Ansichten und Meinungen zu prüfen. Auf einer Ebene genieße ich den Witz in Nootebooms Worten, auf einer anderen erlebe ich die Frustration des Ich-Erzählers mit und auf einer dritten verstehe ich, dass mir hier subjektiv etwas vorgegeben wird, das objektiv („objektiv“ innerhalb der Geschichte) anders aussieht.
Was lernen wir noch aus den Kommentaren des Protagonisten/Ich-Erzählers? Er hegt offensichtlich eine starke Abneigung gegen den Niederländisch-Lehrer. Gründe dafür finden sich problemlos in der Geschichte, die ich 1. noch nicht ausgelesen habe und 2. niemandem durch Spoiler ruinieren möchte. Man lernt durch die Art der Beleidigungen und Bemerkungen aber noch mehr. Es schwingt ein eindeutiger Elitarismus mit. Sprache ist dem Erzähler wichtig, besonders Latein, und die Vorstellung, dass jemand wie sein Konkurrent, ein grober, sportlicher Typ mit Erfolg bei Frauen, Lyrik verfasst – oder das, was er für Lyrik hält –, scheint dem Erzähler absurd. In seiner Gedankenwelt kommen weder moderne Lyrik noch Körpermenschen gut weg. Diese Überlegungen führen sofort zu einem recht unsympathischen Eindruck des Protagonisten. Man könnte außerdem daraus schließen, dass er sein eigenes Aussehen für wenig ansprechend hält und möglicherweise eingeschüchtert von seinem Konkurrenten. Warum sonst sollte er ihn dermaßen schlechtmachen?
Nooteboom hat den Erzähler absichtlich und mit viel Mühe bis zu dieser Stelle unsympathisch gezeichnet, aber auch mit Witz und Gefühl. Warum das alles? Das weiß ich noch nicht.
Nutzt man einen Ich-Erzähler, kommt man nicht umhin, ihn in Beziehung zu anderen Figuren zu setzen – es sei denn, man ist Samuel Beckett und stellt beinahe körperlose Figuren in leere Räume. Das bedeutet, dass man bei Beschreibungen anderer Figuren nicht nur deren tatsächliches Aussehen und Verhalten bedenken muss, sondern auch ihre Beziehung zum Erzähler beziehungsweise umgekehrt. Ein verliebter Erzähler wird Schönheitsfehler als sympathische Extras zeichnen, während ein betrogener Erzähler diese möglicherweise als hässliche Makel hervorheben würde (abhängig von seinem Charakter).
Noch schwieriger wird es, wenn der Ich-Erzähler einer anderen Figur über eine dritte Figur berichtet und dabei eine (offene oder versteckte) Intention hat. In dem Fall ist wichtig, wie die beschriebene Figur wirklich ist, wie der Ich-Erzähler sie wahrnimmt und welches Bild er beim Adressaten hervorrufen will. Beispiel: A. ist durchschnittlich attraktiv, aber B., Ich-Erzähler*in, ist in A. verliebt und findet ihn/sie extrem attraktiv. B. fürchtet, dass C., Adressat*in, Interesse an A. entwickeln und A. ihm/ihr wegschnappen könnte. Daher weist B. vor C. permanent auf die Mängel von A. hin. Wir können aus der Kommunikation zwischen B. und C. nicht direkt auf die Gefühle von B. schließen und auch nicht auf A.’s tatsächliche Attraktivität. Nur in Kombination mit dem Wissen, dass B. in A. verliebt ist, ergibt das Gespräch Sinn. So entstehen auch Intrigen.
Man könnte eine ganze Geschichte nur um die Feinheiten der Kommunikation und Beziehungen verschiedener Figuren zueinander schreiben, ohne dass viel Handlung nötig wäre. Aber wieso „könnte“? Das ist schon mehrmals geschehen. Man denkt nur nicht so häufig darüber nach. Ich denke, dass viele Autor*innen – ich schließe mich da nicht aus – häufig die Techniken, wie sie in diesem Artikel beschrieben stehen, anwenden, ohne darüber nachzudenken. Wir sind es aus dem Alltag gewohnt. Das ABC-Beispiel oben kennen die allermeisten wahrscheinlich noch aus Schulzeiten.
Sich dieser Mechanismen bewusst zu werden, hilft, sie in einer Geschichte besser und zielgerichteter anzuwenden. Vielleicht konnte ich damit irgendwem die Schreibarbeit erleichtern. Ich hoffe jedenfalls, dass ich selbst beim nächsten Mal daran denken werde, wenn meine Figuren miteinander kommunizieren.