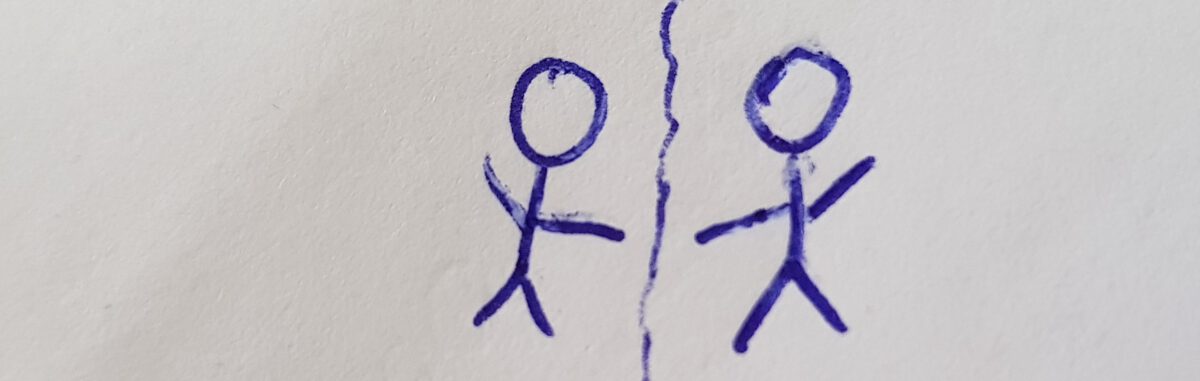Zerstörung, Sachbeschädigung, Gewalt, Krieg und Kampf sind zentrale Motive mancher meiner Werke. Das musste ich selbst erst entdecken. Heute frage ich mich, woher das kommt.
Zerstörung kann reinigend und befreiend sein. Erst als Martin Sorcks Wohnung abbrennt, kann er seine Reise antreten. Manchmal muss man etwas zerstören, um fortfahren zu können: eine Beziehung beenden, eine Regierung stürzen, das Weltei zerbrechen. Bevor ich fortfahre, betone ich sicherheitshalber, dass ich Gewalt nicht verherrlichen oder gar fordern möchte. Es geht hier um Symbole. Zerstörung muss nicht groß sein, um wirkungsvoll zu sein. Nach einer Trennung gemeinsame Fotos zu verbrennen, ist Zerstörung im Kleinen, ist Loslassen und Abschied.
Muss Zerstörung Gründe haben?
Zerstörung der Zerstörung willen scheint mir nicht bloß unsinnig, sondern auch extrem selten zu sein. Immer steckt etwas dahinter und wenn es von außen auch noch so willkürlich erscheinen mag. Mit der passenden Ideologie kann man jede Form von Zerstörung als politische Aktion interpretieren. Denken wir beispielsweise an Maos Kulturrevolution, der nicht nur viele Menschen, sondern auch unbezahlbare, unwiederbringliche, uralte Kunst- und Kulturschätze zum Opfer fielen. Religionen haben immer wieder zu Gewalt- und Zerstörungsorgien aufgerufen. Die Rechtfertigungen für Gewalt und Vernichtung sind so vielfältig wie die Formen ihrer Ausführung.
Es ist daher verständlich und richtig, dass man auf diese Themen mit Vorsicht oder sogar Abneigung reagiert. Genau wegen dieser Vorsicht, Furcht vielleicht sogar, ist die Zerstörung (oder Bedrohung) von Gegenständen wie Menschen stets interessant in der Kunst. Man kann mit der Darstellung schocken, Botschaften verstärken und allgemein starke Gefühle hervorrufen.
Kriegerischer Alltag
Die Welt ist ein Ort der elementaren Unruhe für viele Menschen, jeder Tag ein Kampf und jede Kommunikation eine Auseinandersetzung. Dies kann einerseits an einer entsprechenden Weltsicht liegen, in der es fast ausschließlich Feindbilder gibt, oder schlicht an den psychischen Kapazitäten der betroffenen Personen. Wut und Angst führen zu solchen Leben oder entstehen aus ihnen.
Das Leben als Krieg. Wie stellt man es besser dar als durch die Darstellung von Kriegsgeschehen? Die Mischung aus dem, was die meisten als Alltag erleben (und einige als Kampfgebiet), und dem, was alle als Kriegsgebiet verstehen, ist daher der perfekte (paradoxe) Ort für eine entsprechende Geschichte. Martin Sorck ist eine der Personen, die permanent mit der Welt im Clinch liegen. Seine Welt ist ein Schlachtfeld. Erleben wir nun im Roman, wie er die Welt sieht oder was wirklich geschieht? Das lasse ich offen.
Charakter- und Feldzüge
Der Gedanke des Lebens als Kampf ist natürlich nicht neu, wurde allerdings traditionell anders gedacht: Aus darwinistischer oder (schlimmer noch) aus sozialdarwinistischer Perspektive. Ich allerdings meine keinen tatsächlichen Wettstreit zwischen Personen oder Personengruppen, sondern denke an eine reine Erlebensebene. Der Kampf ist nicht real, sondern nur im Kopf einer Person, in diesem Fall Martin Sorck.
Man kann die Kriegsszenen im Roman Sorck auf vielerlei Weise interpretieren und das ist auch so gewollt. Eine wichtige Lesart ist die angesprochene, dass der Krieg bildhaft für die inneren Umstände des Protagonisten zu verstehen ist. Dass Martin nicht in seine Umgebung passt und ernsthaft mit dem Leben ringt, wird im Roman wohl schnell klar. Eine andere Lesart bezieht sich daher auf die Struktur, die ich im Blogeintrag Sucht und Struktur besprochen habe. Der Aufbau und Ablauf der Landgänge spiegelt den Weg durch die Sucht wider. Die Kämpfe ebenso wie die Zwangssituationen sind Teil der Darstellung. Daher ist, wie im Beitrag gezeigt, auch der Rückschlag für die Reisegesellschaft in Stockholm der erste große Sieg im Kampf gegen die Sucht. Diese beiden Lesarten widersprechen einander nicht, sondern ergänzen sich sogar.
Viele haben die Landgänge und die damit zusammenhängenden Kriegsszenen auch als gesellschaftskritisch gelesen, was absolut legitim ist. Ich kann mir keine gelungene Darstellung eines Krieges oder kriegsähnlicher Zustände vorstellen, die nicht als Kritik an etwas gelesen werden könnte oder müsste. Kritik ist fraglos Teil des Werkes.
Persönliche Aspekte
Ja ja, natürlich spiegelt die Darstellung von Krieg und Zerstörung persönliche Aspekte des Autors wider. Es jetzt noch abzustreiten wäre unsinnig angesichts der Einleitung. Immerhin habe ich bereits verraten, dass es anfangs nicht bewusst geschehen ist. Ich hatte und habe meine Kämpfe, wenn ich auch glücklicherweise niemals im Krieg gewesen bin. Hätte ich Krieg wirklich erlebt, würde ich wohl davon absehen, ihn in meinen Geschichten als Symbol zu missbrauchen.
Die Wahrheit ist, dass mich der besprochene Themenkomplex seit Kindergartentagen interessiert. Ich erinnere mich, wie ich in dem Alter Soldaten und Kriegertypen gezeichnet habe, wie ich fasziniert ein Buch über den Zweiten Weltkrieg durchgeblättert und später heimlich Kriegs- und Actionfilme (deren Genregrenzen in den 90ern oft verwischt waren) geschaut oder (nicht heimlich) mit Action Man Figuren gespielt habe. Der Krieg war überall: Krieg auf Cybertron bei den Transformers (also in Zeichentrickfilmen/-serien), in Filmen, als Teil der Bildung und im Spielzeug (auch wenn ich nicht mit Spielzeugwaffen spielen durfte). Wie kam das? War das eine Mode? Ist das so ein Blödsinn, der passiert ist, weil ich ein Junge war? Habe ich als ausschlaggebendes Elemente genau in dem Moment zufällig einen Kriegsfilm gesehen, als ich herauszufinden versuchte, was man als Junge/Mann auf der Welt so treibt?
Offen gestanden, ich habe keine Antworten auf diese Fragen. Waren die Symbole, die ich heute verwende, also unumgänglich? Wer weiß. Sie haben jedenfalls eine von meiner Kindheit völlig losgelöste Bedeutung.
Krieg in der Literatur
Natürlich habe ich irgendwann Im Westen nichts Neues von Remarque gelesen und es hat mir ebenso gefallen wie die anderen Bücher, die ich von ihm kenne. Hesse hat eine Weile auch mit futuristischen Gedanken und Kriegssymbolik gespielt, bis der große Krieg dann kam und Hesse seine Fehler einsah. Von Sun Tzu (Kunst des Krieges) über Mao (Theorie des Guerillakrieges) bis zu Carl von Clausewitz (Vom Kriege) und Winston Churchill habe ich einiges zum Thema gelesen. Teils lag es an den in meiner Jugend im Haus befindlichen Bücher und teils an einem Interesse, das sich unter anderem aus der Lektüre dieser Bücher ergeben hat. Aber wo steckt nun der Kern meiner Faszination?
Vielleicht ist es das schier unfassbare Ausmaß an Leid, Organisation, generationenlangen und Kontinenten überspringenden Auswirkungen, Propaganda und immer wieder Leid, das mit Kriegen zusammenhängt und das wohl niemand geistig ganz erfassen kann. Ein Krieg, gerade in den letzten 200 Jahren, ist ein so enormes und derart grässliches Ereignis, dass es sich ins Gedächtnis und die Seele der Menschheit für Generationen einbrennt. Angesichts dessen schämt man sich für jede symbolische Verwendung des Krieges. Ich bin mir sicher, dass es noch Rückstände der Erfahrungen meines Urgroßvaters aus dem Ersten Weltkrieg in mir gibt, ob nun durch Erziehung oder die Gene weitergegeben, und ebenso welche meiner Großväter aus dem Zweiten Weltkrieg.
Vielleicht war Sorck am Ende ein Ventil, um einen Teil dieser Grässlichkeit in mir loszuwerden, und wenn es auch in verdrehter Form geschehen ist.
Abschließend sollte ich eine Selbstverständlichkeit betonen: Ich hoffe, niemals in den Krieg ziehen zu müssen und dass ich weder mit diesem Blogeintrag noch mit meinem Roman Personen zu nahe getreten bin, die echte Kriegserlebnisse durchmachen mussten.