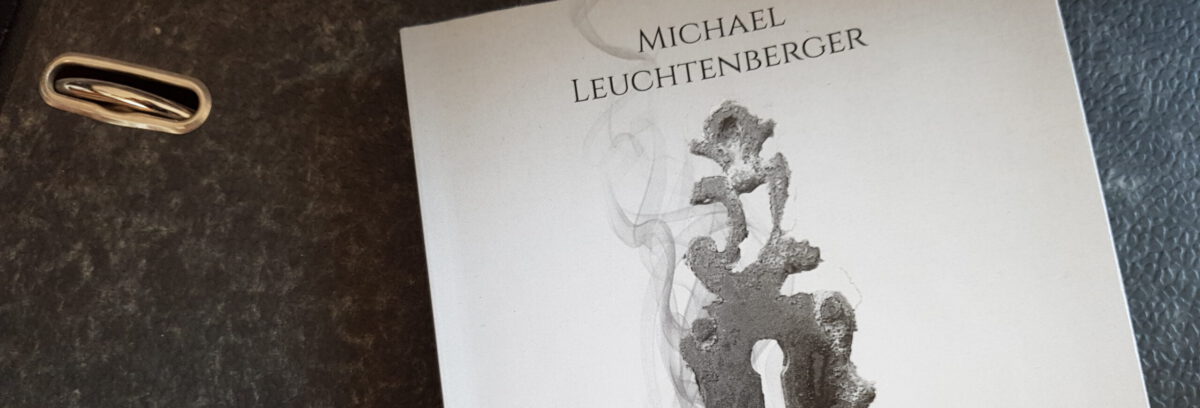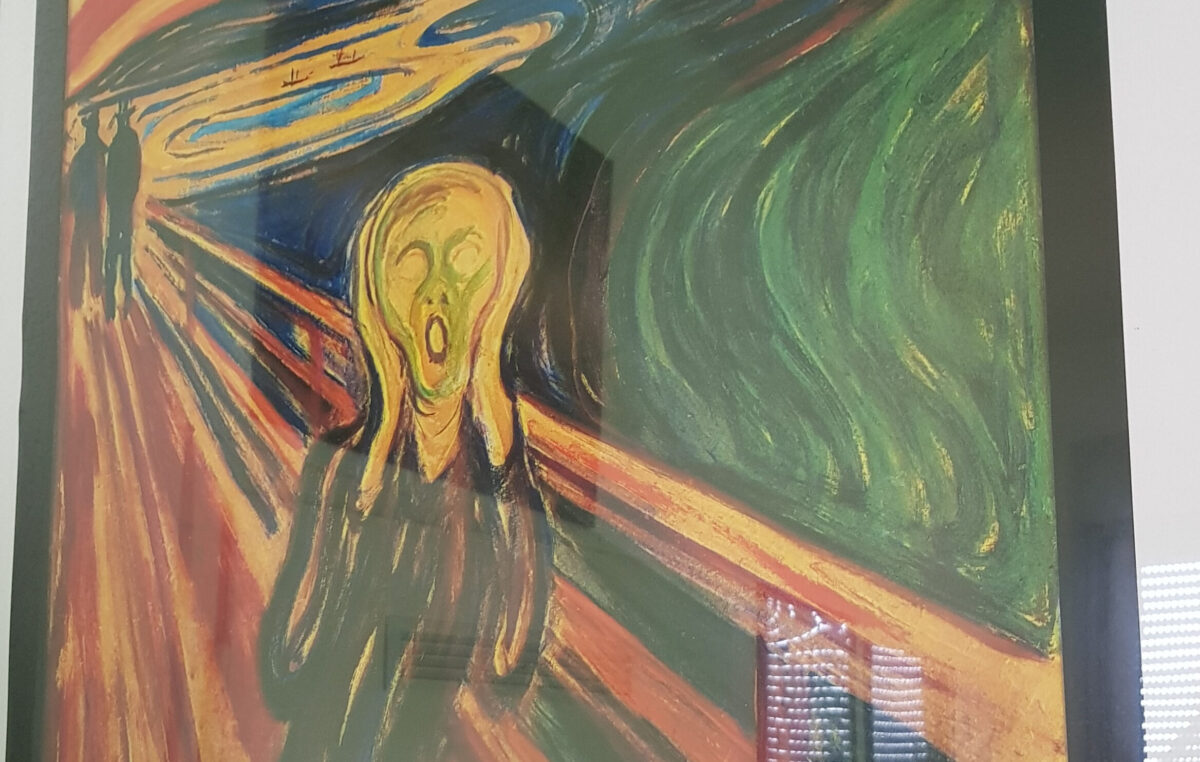Mein Name ist Michael Leuchtenberger, ich schreibe und lese mit Vorliebe Horror-geschichten und übersinnliche Thriller. Und manchmal denke ich darüber nach, warum eigentlich.
Wenn jemand zum Beispiel über eines meiner Werke schreibt: „Es ist schon lange her, dass ein Buch mich so viele Fingernägel gekostet hat“, macht mich das als Autor glücklich. Ich verbreite gerne Angst und Schrecken, lasse mit Vergnügen Monströses und Unbegreifliches auf mein Publikum los. Weil ich Leute quälen will? Nein. Ich bin einfach überzeugt, dass andere an Horror genauso viel Freude haben wie ich.
Horror, das gemütliche Heim
Ich kann Bücher durchaus aus anderen Gründen interessant finden. Wegen Themen, Figuren, dem Humor. Der Abwechslung und neuer Eindrücke wegen lese ich zwischendurch gern andere Genres. Aber immer wieder kehre ich sehr schnell zum Horror zurück, was sich anfühlt, wie nach Hause zu kommen.
Es ist gar nicht nötig, mich deswegen als Sonderling zu inszenieren. Horror ist ein Genre mit jahrhundertelanger Tradition und großer Anhängerschaft. Auch über den Reiz und die Funktion von Schauerliteratur wurde schon viel geschrieben, Stephen King tat dies in „Danse Macabre – Die Welt des Horrors“, Lovecraft in seinen Essays noch viel früher. Trotzdem möchte ich der Frage „Warum Horror?“ einmal persönlich und unbefangen auf den Grund gehen.
Denn ich kann verstehen, dass viele einen weiten Bogen um Horror machen. Wer hat schon gerne Angst?
Eine berechtigte Frage, aus der sich die nächsten ergeben: Was stimmt nicht mit mir, dass ich – zumindest beim Lesen und Schreiben – eine Freude daran habe, mich zu fürchten oder zu ekeln? Warum kriege ich nicht genug von Geschichten, in denen andere Todesängste ausstehen, wahnsinnig werden oder qualvoll umkommen? Und warum muss es auch in meinen eigenen Geschichten düster und bedrohlich zugehen?
Horror beruhigt!
So sehr das Lesen als Leidenschaft Menschen vereint, so divers scheinen zumindest auf den ersten Blick die Bedürfnisse zu sein, die die erzählten Geschichten befriedigen. Sie bewegen sich zwischen zwei Extremen: Will ich etwas lesen, das mich beruhigt, oder etwas, das mich beunruhigt? Sollen Bücher mir ein Gefühl der Bestätigung, Geborgenheit und Sicherheit geben? Oder mir suggerieren, dass möglicherweise etwas „da draußen“ ist, das genau diese Sicherheit bedroht?
Ich habe mich schon immer für die zweite Option entschieden. Aber etwas daran erscheint mir widersprüchlich: Auch ich lese doch, um mich abzulenken. Auch ich will dabei den Alltag zurücklassen. Warum lese ich dann etwas, das mir Furcht einflößt?
Doch vielleicht ist da gar kein Widerspruch. Denn ich schalte ab, gerade weil die Geschichten spannend und gruselig sind. Sie fesseln mich – während Bücher, mit denen andere sich pudelwohl fühlen, in denen aber nur Alltägliches geschieht und Harmonie herrscht, mich sofort langweilen. Von Abschalten kann dann bei mir keine Rede sein.
Als Beispiel: Eine realistische Erzählung über die Donner Party, die 1846 tatsächlich in Nordamerika verschwand, mag an sich schon interessant sein. Aber wenn die Reisenden plötzlich von fremdartigen Bestien heimgesucht werden, wie in Alma Katsus Roman „The Hunger“, fängt für mich der Spaß erst richtig an. Andere dagegen verstört es allzu sehr oder sie rollen ob dem Dreh ins Phantastische abschätzig mit den Augen.
Zugespitzt kann ich sagen: Die Unruhe einer Horrorgeschichte beruhigt mich. Habe ich also doch das gleiche Grundbedürfnis wie die, die Liebesromane oder die Känguru-Chroniken lesen?
I want to believe – but I can’t
Dass ich Horror überhaupt so erleben kann, liegt daran, dass ich zwischen Realität und Fiktion sehr klar trenne. Das ist keine besondere Leistung, sondern mein Wesen. Ich kann gar nicht anders. Ich neige nicht zu Albträumen und habe – auch nach einem gruseligen Film – noch nie Angst gehabt, einen langen, dunklen Flur entlang zu gehen. Ja, beim Schreiben habe ich eine blühende Fantasie. Aber dafür lege ich einen Schalter um. In meinem Alltag bin ich Realist. Und manchmal fast neidisch auf Leute, die mehr sehen als das, was in meiner Wirklichkeit existiert.
Die Anspannung, die ich beim Ansehen eines gruseligen Film verspüre, empfinde ich als sehr positiv. Diese Spannung macht den Reiz am Horror für mich aus, während ich mit Splatter nichts anfangen kann und bei explizitem Body Horror schnell an eine Ekelgrenze stoße. Echte Angst empfinde ich nicht, oder zumindest überträgt sie sich nicht von der Fiktion in meine Realität.
Vielleicht gerade weil das so ist, habe ich schon immer eine Sehnsucht nach fiktiven Welten verspürt. Schon als Kind habe ich Märchen und fantastische Geschichten geliebt, in denen Reales auf Phantastisches trifft, allen voran „Die unendliche Geschichte“, später die Reihe „Wintersonnenwende“ und Jules Vernes Erzählungen über abenteuerliche Reisen.
Das morbide Kind
Schon damals haben mich die finsteren Elemente, die Geister und Ungeheuer, am meisten fasziniert. Ygramul und Gmork. Der Afanc. Die kreischenden Wilddruden in „Ronja Räubertochter“. Oder die Vorstellung, wie Professor Lidenbrock in einen Vulkan hinabzusteigen, der direkt in den Mittelpunkt der Erde führt – höllische Assoziationen inklusive.
Der Hang zum Morbiden setzte sich nahtlos fort, als ich Stephen King entdeckte, etwa seine Reihe „Der dunkle Turm“, später die Klassiker von Poe, Lovecraft und E.T.A. Hoffmann. In die gleiche Zeit fiel der Hype um die Serie „Akte X“, der auch mich voll erwischte. Der Kosmos voller Monster, Mutanten und sonstiger unerklärlicher Phänomene hatte es mir angetan. Der spezielle Reiz lag für mich auch hier wieder im Einbruch des Übersinnlichen in eine ansonsten realistische Welt.
Und natürlich stehen auf der Liste meiner Lieblingsfilme die schaurigen und rätselhaften ganz weit oben. „The Shining“ zieht mich vor allem mit seinem unheimlichen Ort in seinen Bann: das labyrinthische Overlook-Hotel spricht eine Urangst an, die mir auch in meinen Träumen und eigenen Texten immer wieder begegnet. Oder „Mulholland Drive“, das mir als Musterbeispiel dafür scheint, wie nah eine Geschichte an einem verwirrenden Albtraum sein, wie sie mit Identität und Realität spielen und damit das Publikum verunsichern kann.
Ist die Realität nicht schlimm genug?
Für die Sehnsucht nach dem Phantastischen habe ich schon eine mögliche Erklärung genannt, aber warum dieser ständige Hang zur Düsternis? Das ist eine Veranlagung, die nicht nur mit Geschichten zu tun hat. Auch Musik hat eine große Bedeutung für mich, und von ein paar Ausnahmen abgesehen sind es dunkle, melancholische Klänge, die mich besonders anziehen, Richtungen wie Darkwave, Coldwave und verwandte. Erkenne ich mich darin wieder? Bestätigen dunkle Geschichten und schwermütige Musik meine Weltsicht?
Während ich das schreibe, merke ich, wie es mir widerstrebt, in eine Schublade gesteckt zu werden. Ja, ich bin introvertiert und kein Partymensch. Aber nicht spaßbefreit oder ständig deprimiert. Nicht nur Grusel und Gothic haben mich geprägt, sondern auch Loriot und „Friends“. Ich liebe den Sommer und höre auch mal normale Popsongs.
Aber mir wäre eine reine Spaßgesellschaft zuwider, in der alles, was dunkel und bedrohlich ist, verdrängt wird. Ja, die Realität ist schlimm genug, und vielleicht will ich das Böse gerade deswegen auch in Geschichten erleben, das Nachdenkliche in der Musik hören. Davon lesen, sehen oder hören, dass Menschen Angst haben, weil das zu jeder Existenz dazugehört. Bei zu viel Happiness klingen in mir Alarmglocken: Oberflächlich! Heuchlerisch!
Das Ventil oder: Horror ist ein Kinderspiel
Das läuft nicht immer bewusst ab. Und es ist vor allem nichts darüber gesagt, ob ich mit dem Grauen im realen Leben besser umgehen kann als andere, nur weil ich mich in der Fiktion ständig damit konfrontiere. Denn das bezweifle ich. Nicht umsonst ist es meist phantastischer Horror, der mich besonders begeistert, seltener die Stories über Serienkiller oder andere, ganz irdische Gräueltaten.
Ich stimme King daher zu, wenn er – wie in “Danse Macabre” – Horrorgeschichten als eine Art Sicherheitsventil für reale Ängste beschreibt. Er spricht an dieser Stelle von den Konsument*innen von Horrorfilmen, aber ich glaube, es lässt sich auf Lesende und auch die Autor*innen übertragen.
Das Ventil scheint bei mir zudem seinen Zweck zu erfüllen, obwohl oder gerade weil ich die Angst in der Fiktion nicht als real Angst erlebe. Sind es am Ende dann also doch wir Horrorfans, die vor der Realität flüchten? Haben andere das Überdruckventil gar nicht nötig, weil sie die wahren Schrecken unserer Welt besser verarbeiten?
Wahrscheinlich ist es so, wie Matthias, der Betreiber dieses Blogs, es gedeutet hat (nachdem ich ihm den ersten Entwurf dieses Artikels zum Gegenlesen zuschickte, der an dieser Stelle endete): Horror hat etwas von einem Kinderspiel, von einer Probe für den Ernstfall. Ich weiß um das Übel in dieser Welt und habe Angst davor, damit eines Tages unvorbereitet konfrontiert zu sein. Mit diesem Gedanken kann ich mich sehr gut anfreunden, da ich beispielsweise auch nicht selten über den Tod nachdenke.
Von Horrorfans wie Nicht-Horrorfans würde mich interessieren: Was sind eure Gedanken dazu?

Michael Leuchtenberger (Jahrgang 1979) veröffentlichte 2018 als Selfpublisher seinen Debütroman, den geisterhaften Thriller Caspars Schatten. 2019 gewann er mit seiner Kurzgeschichte Lampionfest den Schreib-wettbewerb zum Thema Zeitgeist 2020 von Litopian e.V. Ebenfalls 2019 erschien mit Derrière La Porte – elf sonderbare Kurzgeschichten sein erster Erzählband. Aktuell arbeitet er an einer Fortsetzung seines Debütromans mit dem Arbeitstitel Pfad ins Dunkel.
(Fotograf: Matthias Hewing)
Auf Papierkrieg.Blog bisher über Michael Leuchtenberger erschienen:
Michael Leuchtenberger: Derrière la Porte | Alte Akten und wilde Spekulationen