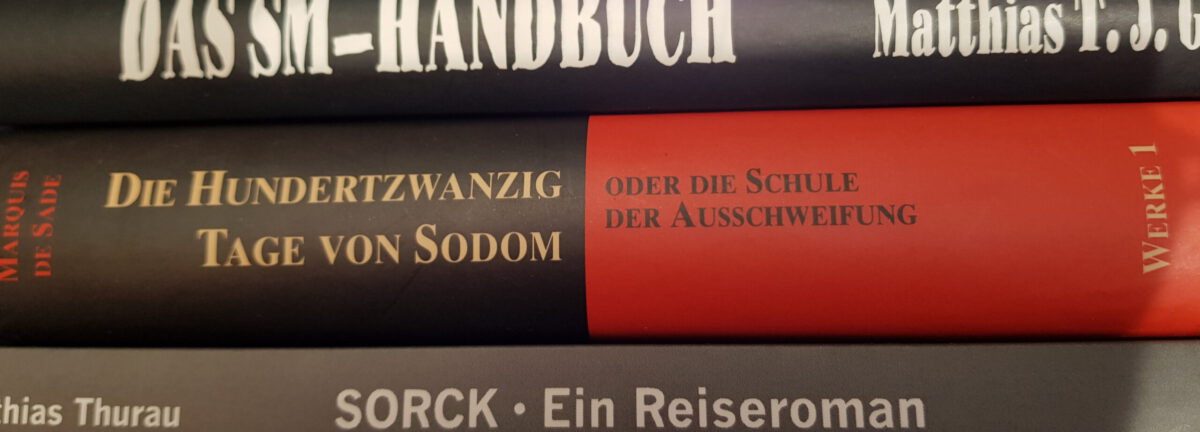Vor Kurzem bin ich über ein älteres Roman-Manuskript gestolpert und habe es gelesen. Anfangs war ich begeistert, dann verwirrt und schließlich etwas enttäuscht. Mir fiel wieder ein, welche Konzept-Idee hinter allem stand und erst mit viel Abstand habe ich erkannt, warum dieses Konzept nicht funktionieren kann.
Die Geschichte ist im Grunde auf drei Parts aufgeteilt. Zunächst wird eine Geschichte erzählt, die von einem fiktiven Autoren stammt. Im zweiten Teil werden die Poetik, sein Warum und seine Herangehensweise in Ich-Perspektive beschrieben. Im Dritten Teil zieht der fiktive Autor los und macht eine Reise rückwärts durch sein Leben.
Die Idee war, schrittweise durch ein Werk zu seinem Ursprung zu zoomen: Geschichte – bewusste Idee – unterbewusste Ursprünge; oder: Werk – Idee des Autors – Leben des Autors. Es sollte immer Bezüge geben zwischen den Ebenen, sodass man sehen kann, wie sich Erlebnisse zu Ideen und dann zu Geschichten entwickeln (für diesen einen Fall). Es sollte also um die alte Frage gehen, wie viel vom Schreibenden im Geschriebenen steckt. Gleichzeitig hätte das Buch im gleichen Verhältnis zu mir gestanden wie der erste Part des Buches zum fiktiven Autoren. Ich hatte für mich wiederum eine Poetik (und eine konstruierte Idee) erschaffen und konnte diese auf meine Erlebnisse zurückführen, beziehungsweise die Leser*innen hätten die Existenz meiner Ideenkonstrukte und der vorausgehenden Erlebnisse als Möglichkeit im Kopf gehabt.
Das angesprochene Konzept funktioniert allerdings nicht, jedenfalls nicht in der Form, wie ich es mir gedacht hatte. Problematisch ist zuallererst die Einteilung in voneinander weitestgehend gelöste Parts. Das ist für viele Leser*innen ungewohnt. Episoden-Romane gibt es natürlich, aber die wenigsten Autor*innen können ihren Leser*innen so etwas vorsetzen (und positive Rückmeldungen erwarten). Ohne das Konzept zu erklären und damit darauf hinzuweisen, dass man auf Parallelen und Details zu achten hätte, wäre es schwierig nachzuvollziehen gewesen.
Noch schwieriger ist der Poetik-Part, weil er für die allermeisten Lesenden ziemlich langweilig sein könnte (und in der vorliegenden Manuskript-Form sogar für mich war). Es liest sich, als hätte man zwei interessante Geschichten gehabt und dann einen Vorlesungsentwurf dazwischen gezwängt.
Der Mittelteil müsste also geändert werden, das heißt, er müsste vollends getilgt und ersetzt werden, wenn man überhaupt noch das Buch als ein einziges Werk zusammenhalten wollte. Immerhin sollte man nicht vergessen, dass der erste und der dritte Part jeweils auch als Geschichten für sich funktionieren. Diese beiden Teile müssten ebenfalls stark überarbeitet werden, aber würden eben funktionieren, während der Mittelteil komplett anders zu sein hätte. Man müsste ihn mindestens aufpeppen. Beispielsweise könnte man ihn als Interview oder Dialog schreiben, als Szene in einem Dokumentarfilm, beziehungsweise könnte man es so darstellen, als würde diese Szene gerade gedreht oder vorbereitet werden. Dadurch gäbe es mehr Action, mehr zu sehen sozusagen. Allerdings läge der Fokus nicht mehr auf den Infos, die für das Gesamtkonzept, sofern man es beibehalten möchte, nötig sind. Man könnte außerdem die Infos aus dem Poetik-Teil direkt als Reflexion in den Erlebnis-Part einbauen. Das würde möglicherweise die Erlebnisse weniger spannend machen und den Dreischritt der Ideenentwicklung verzerren, da Part Eins eigenständig dastünde und Part Zwei und Drei zusammengepresst und verdreht wären. Die Auftrennung, die das Projekt problematisch macht, scheint für das Grundkonzept notwendig zu sein.
Lassen wir diese Aspekte mal eben beiseite.
Ihr kennt das Manuskript nicht, was es schwieriger macht, darüber zu berichten. Teil Drei des Buches ist eine relativ straighte Fortsetzung einiger Punkte, die in Teil Zwei bereits erwähnt werden, kann aber auch für sich stehen. Wäre er ein Film, würde ich diesen Part als Road Movie bezeichnen. Eine chronologisch ablaufende Reise über einzelne Stationen, die jeweils einen zeitlichen Schritt zurück in die Kindheit darstellen, bis der Protagonist im Elternhaus ankommt. Somit können die Leser*innen den Lebensweg des fiktiven Autors der ersten beiden Parts nachvollziehen. Der erste Teil des Buches aber ist ein hochkomplexes Spiel mit Identität(en) und Realität(en) auf mehreren Ebenen. Das bedeutet, dass dieser erste Part für sich bereits schwierig ist und als Element innerhalb des Romans kaum handzuhaben ist. Ein Teil der Komplexität entsteht dadurch, dass bereits Aspekte des Gesamtkonzepts, also Vorgriffe in die restlichen zwei Drittel des Buches, mit eingearbeitet sind. Die Komplexität ist wiederum notwendig und problematisch. Zwar könnte man den Aufbau des Romans erklären, indem man sagt, dass das Chaos immer weiter aufgeräumt wird, indem es sozusagen doppelt gefiltert und erklärt wird: durch die Poetik und durch die Erlebnisse. Aber praktisch betrachtet, wäre das Ergebnis schwer zu ertragen. Dem Konzept steht also nicht nur der Mittelteil im Weg, sondern in diesem Fall auch das erste Drittel.
Ich könnte wohl eine neue, einfachere Geschichte fürs erste Drittel erfinden, den Mittelteil ersetzen und den letzten Part hart überarbeiten, aber sinnvoller wäre es wohl, das arme Ding zu erschießen. Als ich das Manuskript damals fertiggestellt hatte, wusste ich, dass ich es nicht veröffentlichen kann, aber ich wusste noch nicht recht, warum eigentlich nicht. Genau deshalb lasse ich Manuskripte eine Weile ruhen, bevor ich mich nochmals an die Arbeit setze. Ich lerne in der Zwischenzeit dazu und bekomme Abstand vom Werk. Wichtig ist dies auch für meine manchmal etwas überzogenen Ideen: Wenn ich 6 Monate nach Fertigstellung des Manuskripts nicht mehr verstehe, was ich gemeint hatte, werden es die Leser*innen wohl auch nicht verstehen können. Und ja, das kommt vor.
Ich betrachte diesen Blogeintrag übrigens nicht als Geschichte eines Scheiterns, sondern als Zusammenfassung eines Entwicklungsschrittes. Man soll und muss bereit sein, die Arbeit von vielen Monaten nachträglich als Übung zu betrachten, anstatt sie in die Welt zu zwingen. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass als Nachhall der Gedanken, die ich hier zusammengefasst habe, tatsächlich eine Lösung auftreten wird. Geschieht dies nicht (wovon ich ausgehe), werde ich das Manuskript ausschlachten und die Einzelteile recyclen. Part Eins und Part Drei jeweils als Erzählungen zu veröffentlichen, wäre eine Idee. Man könnte sie in einem Buch zusammenfassen, Part Zwei überspringen (beziehungsweise in den Kopf der Leser*innen verlagern) und die Parallelen zwischen beiden Erzählungen verdeutlichen. Packen wir’s an!