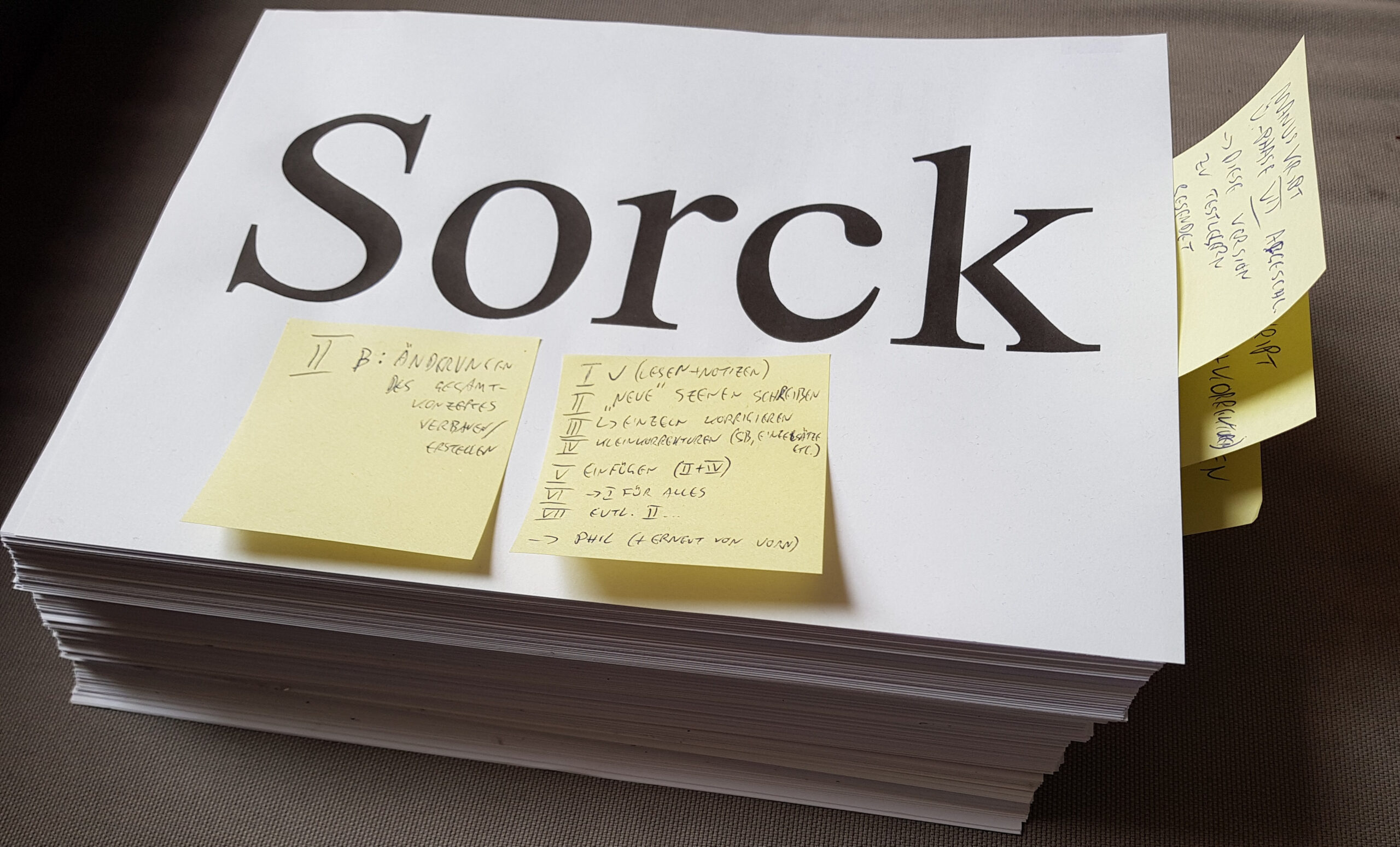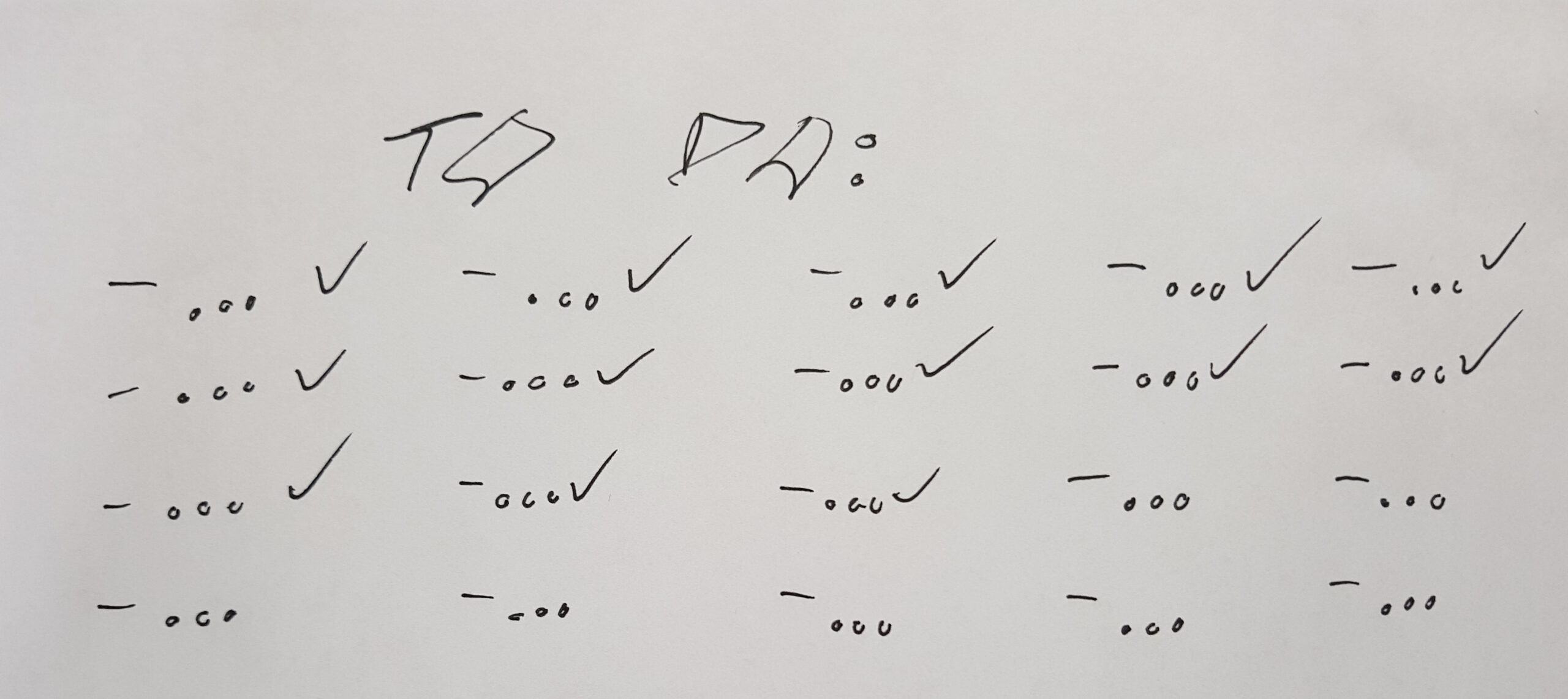Dortmund bietet mehr als Bier und Fußball. Zum Glück. Es gibt zum Beispiel ein hervorragendes Ballett-Ensemble, das unter Leitung Xin Peng Wangs jedes Jahr eine neue, eigene Literatur-Adaption auf die Bühne bringt. In der Spielzeit 2019 ist es der zweite Teil der Reihe nach Dantes Comedia: Purgatorio.
Die Divina Comedia (Göttliche Komödie) ist eines der wichtigsten Werke der Weltliteratur und sei hier ganz kurz zusammengefasst:
Teil 1: Inferno – Dante wird von Vergil durch die Hölle geführt
Teil 2: Purgatorio – Dante begutachtet den Läuterungsberg
Teil 3: Paradiso – Dante schaut den Himmel
Dass man die Comedia ein Leben lang studieren kann und nicht fertig werden würde, darf auch erwähnt werden. Dante fasste das Wissen seiner Zeit in einem Werk zusammen, erschuf die Grundlage der Höllenvorstellung des Christentums (Feuer, Schwefel etc.) und schrieb das alles in Italienisch, das es damals in der Form noch nicht gab, weshalb er hunderte Worte erfinden oder adaptieren musste.
Was ist der Läuterungsberg?
Purgatorio, im Deutschen oft als Fegefeuer übersetzt, obwohl das Fegefeuer bloß ein Teil des Purgatorio darstellt, ist ein Bereich im Nachleben, wo sündige Seelen sich reinigen von ihrer Schuld, um danach den Himmel zu betrachten und Teil haben zu dürfen an Gottes Wärme. Es ist ein Bereich zwischen dem Himmel, in den nur die reinen Seelen eingelassen werden, und der Hölle, in der die verlorenen Seelen für immer leiden. Wer nicht gut genug für den Himmel ist und nicht nicht schlecht genug für die Hölle, darf einige Jahrhunderte lang leidend einen Berg erklimmen, um am Ende durch eine reinigende Feuerwand zu laufen und danach erlöst zu werden.
Losgelöst von allem Christlichen, was bleibt von der Idee des Purgatorio? Schuld, Schuldgefühl, Reue und ein reinigender Weg, an dessen Ende Vergebung, Ruhe und Klarheit stehen. Es bleibt ein Prozess hin zu etwas, das wir alle anstreben und von dem wir ständig weiter zu entfernen scheinen. Wie setzt man das als Ballett um?
Es beginnt mit der Nachstellung einer Performance der Künstlerin Marina Abramovic und zwar The Cleaner. Jemand sitzt auf einem Berg blutiger Knochen und reinigt in mühsamer Arbeit einen nach dem anderen. Als Kommentar zum Ende der Kosovo-Krise konzipiert, passt das Werk auch allgemeiner zum (Selbst-)Reinigungsthema des Purgatorio.
Ein weiteres Motiv, das auftaucht und den ersten Part des Stückes mitbestimmt, ist das Schlagen mit der flachen Hand auf Hals und Glieder, das die Seelen wieder und wieder vollführen. In der chinesischen Medizin gilt dieses rhythmische Schlagen als heilsam und reinigend, weil es die Körpersäfte und -energien weckt und sie fließen lässt.
Für die größte Zeit wird das Stück Become Ocean von John Luther Adams gespielt, ein Stück, das das langsame Aufbäumen, Aufbauen, Brechen und Zerfließen einer Welle darzustellen versucht. Wasser als reinigendes Mittel und Teil fast jeder großen Religion. Es wird langsam getanzt und im Dunkeln. Schwer wiegt noch die Last der Sünden auf den Seelen. Doch mit der Zeit und nach viel Mühe, wenn die Welle John Luther Adams den Schmutz fortgetragen hat, lockern sich die Glieder, das Atmen wird einfacher, die Bewegungen leichter. Man nähert sich der letzten, reinigenden Feuerwand des Fegefeuers. Kate Moores The Art of Levitation scheint die Gravitation auf der Bühne aufzuheben, im Feuer wirbeln die Seelen, Tänzerinnen und Tänzer drehen sich, springen und tanzen auf Spitze durchs Fegefeuer, befreit von aller Last des Lebens.
Ich sitze im Publikum und merke, wie meine Beine zittern. Anspannung und Konzentration zwangen meine Muskeln, straff und kampfbereit zu sein. Nun lockern sie sich. Die Vorstellung, Buße tun zu können und dadurch alle Last meiner Irrtümer, Fehlhandlungen und Gemeinheiten loszuwerden, stimmt mich euphorisch und dann traurig, weil ich mangels des richtigen Glaubens nicht an ihr festzuhalten vermag. Doch geht es in Purgatorio nicht um christlichen Glauben, sondern um menschliche Bedürfnisse. Vielleicht ist das Fegefeuer die Summe der Schuld, die wir anhäufen, mit uns tragen und die uns zu besseren Menschen macht, bevor wir im Wissen, dass wir sie durch gute Taten abbezahlt haben, am Ende unseres Lebens einschlafen. Bessern wir uns nicht nach Ansicht und Einsicht unserer Fehler, werden sie immer an uns nagen, ohne dass Linderung kommen wird. Das wäre dann die Hölle.
Was kann man von einem Ballett mehr erwarten, als Schönheit, Eleganz, kunstvolle Gestaltung, gekonnte Umsetzung und Wellen von Gefühlen, die zu Kontemplation führen und uns letztlich, mit etwas Glück, zu besseren Menschen machen (wenn auch nur für einen Abend)?