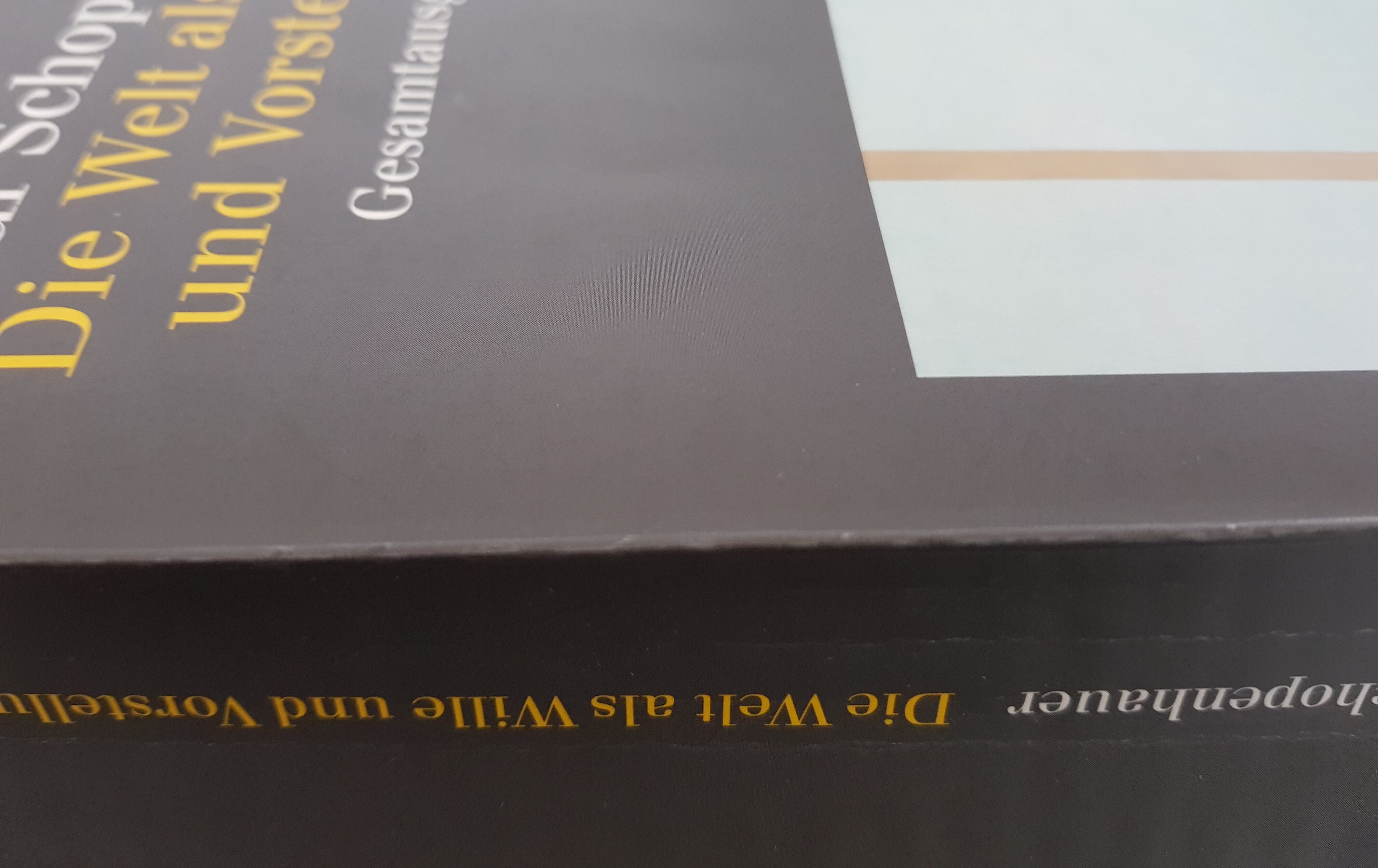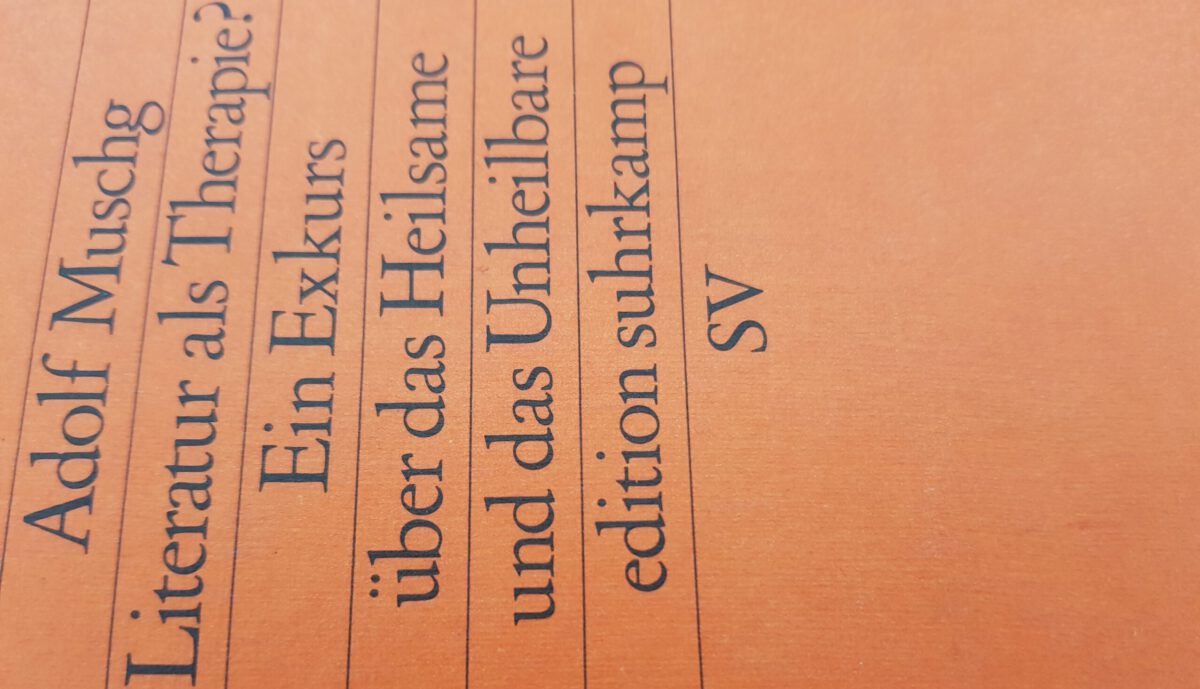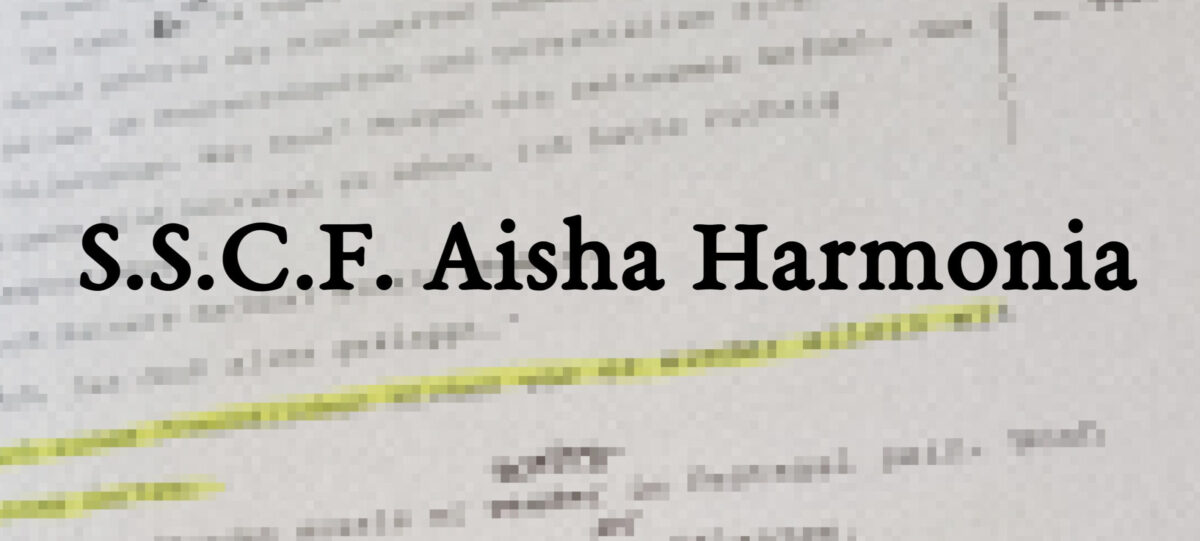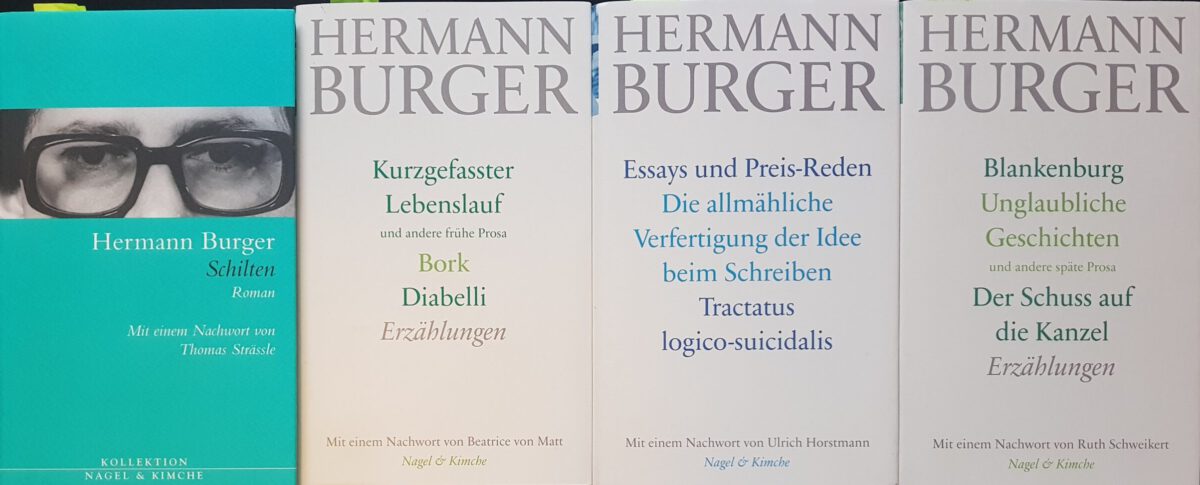Der Reiseroman Sorck ist ein fiktionales Werk. Daran gibt es keinen Zweifel. Wie es bei vielen fiktiven Geschichten allerdings der Fall ist, hat das Werk etliche Wurzeln in der Realität und greift Geschehnisse auf, die wirklich passiert sind. In diesem Eintrag soll es weniger um die konkreten Vorlagen für Szenen des Buches gehen, sondern mehr um die Idee von Sinnzusammenhängen in der Literatur, wo in der Realität keine bestehen. Dennoch könnte es mir passieren, dass minimal gespoilert wird.
Wer Sorck gelesen hat, weiß, dass meine Reise auf einem Kreuzfahrtschiff niemals so ausgesehen haben kann. Die Reise an sich, also eine Kreuzfahrt mit Landgängen an den im Buch vorkommenden Stellen und Besuchen in den meisten der beschriebenen Orte, habe ich 2013 mit meinem Bruder und meinen Eltern gemacht. Damals hatte ich noch keine Ahnung, dass ich einmal einen Roman darauf fußen lassen würde. Ansonsten hätte ich vermutlich mehr Fotos geschossen und mehr Notizen gemacht. Mein Bruder und ich teilten uns eine Innenkabine, ähnlich der, die Martin Sorck im Buch bewohnt. Ich kann mich an keinen Reisetag erinnern, an dem ich mich nicht in den Schiffsbars betrunken hätte, also wäre die Parallele ebenfalls abgehakt. Niemand wird ernsthaft gedacht haben, dass ich mir so viel Suff zusammenspinne, um eine Figur zu zeichnen, oder? Eines Nachts kam ich in die Kabine zurück und mein Bruder schlief bereits. Als ich das Licht anmachte, wachte er halb auf und schlug mehrmals auf das Bild eines Sonnenaufgangs an der Wand, weil er im Halbschlaf dort die Lichtquelle vermutete. Das könnte der Ursprung meiner Idee des Wandbildes im Roman gewesen sein. Leider basieren einige Szenen, die im Buch allerdings massiv überspitzt wurden, ebenfalls auf Erlebnissen. Das Ende des Besuchs im Petersburger Museum kommt in Sorck tatsächlich extrem nahe an das heran, was damals dort geschah. Eduardo hat ebenfalls eine reale Vorlage in einem sehr sympathischen Kellner, den ich leider nicht näher kennenlernte.
Wie bereits gesagt, habe ich alle realen Vorlagen überspitzt, verändert und erweitert, ihnen einen anderen Rahmen verpasst und Geschehnisse hinzuerfunden. Der Roman hat mit den Geschehnissen, die ich erlebte, so viel zu tun, wie ein Haus mit einem Berg, aus dem die Mauersteine geschlagen wurden.
Doch was, wenn ich alle Geschehnisse nacherzählt hätte, wie ich sie erlebte? Das wäre eine Autobiographie. Stelle ich aber einen Erzähler dazwischen und eine Figur, die nicht ich bin – das sollte ich hier ganz deutlich sagen: Martin Sorck bin nicht ich, auf den Gedanken sollte hier niemand verfallen –, ändert sich alles. Dadurch, dass aus einem realen Geschehnis das Erlebnis einer fiktiven Figur wird, wird auch das Geschehnis fiktiv und steht in anderem Kontext. In der Realität gehorchen Geschehnisse lediglich den Gesetzen der Kausalität – Newton sitzt unter dem Baum, es ist windig, der Apfel wurde ausreichend geschüttelt und ist reif genug, also fällt er herunter –, während in der Literatur den gleichen Geschehnissen ein Sinn zugeordnet wird: Newton musste exakt dort sitzen, der Apfel fiel nicht zufällig, sondern nur und mit dem vorgefassten Plan, der Figur Newton die Idee der Gravitationsgesetze einzuhämmern. Betrinkt sich der Autor Matthias Thurau auf einem Kreuzfahrtschiff, sagt das vielleicht etwas über seinen Charakter und sein Leben aus, aber ist keineswegs notwendig für sein weiteres Leben, nicht geplant, nicht Teil eines größeren Sinnzusammenhangs. Betrinkt sich die Figur Martin Sorck, hat das einen Sinn und kann innerhalb des Kontexts des Romans verstanden werden. Das, was wir Schicksal nennen, ist in der Literatur Standard, während es in der Realität bloß die Hoffnung auf eine Bedeutung unserer Existenz ausdrückt. Möglicherweise entstand die Literatur aus dem gleichen Gedanken und hat daher diese Parallelen. Tschechows Gewehr besagt, dass ein Gewehr (→ irgendein Gegenstand, Bestandteil), das am Anfang der Geschichte an der Wand hängt (→ auftaucht, erwähnt wird), spätestens am Ende der Geschichte zum Einsatz kommen muss (→ nicht überflüssig sein darf). In der Realität ist ein Gewehr bloß ein Gewehr – ohne Gewehr gibt es keinen Tod durch Erschießen, aber nur weil die Waffe vorhanden ist, bedeutet das nicht, dass unbedingt jemand sie benutzen muss (oder, um es komplizierter zu machen, es eine besondere Bedeutung hätte, wenn jemand es eben nicht benutzt). Dieses Spiel der Bedeutungen von Dingen, die im echten Leben bedeutungslos sind, habe ich im Roman hier und da auf die Spitze getrieben und beispielsweise Sinn in Zahlen (Zimmernummern etc.) codiert.
Eine Bemerkung zu einem Effekt, den ich immer interessant fand und der an das Thema anschließt: Das Leben eines Menschen wird gerne von seinem Tod oder seinen Lebenshöhepunkten aus interpretiert. Sartre verstand das bereits als Kind (oder behauptete dies in Die Wörter). Er zitierte Zeilen aus Büchern, die er nicht verstand, oder sagte kryptische Dinge, die keinen Sinn hatten, aber so klangen, als hätten sie welchen, mit dem spezifischen Ziel, den Erwachsenen die Erinnerung daran zu geben, dass er bereits als Kind dazu auserkoren war, ein Schriftsteller und Philosoph zu werden. Vor einiger Zeit hörte ich im Radio von einem Fußballer, der bereits als Kind und Jugendlicher lieber Fußball gespielt hat, als zur Schule zu gehen. Hier spürt man es deutlicher als bei Sartre: es gibt unzählige Kinder und Jugendliche, die lieber Fußball spielen, als zur Schule zu gehen. Aus den meisten wird aber kein Profi. Aus Sartre hätte auch kein Schriftsteller werden müssen. Die Bedeutung wird erst im Nachhinein hinzugedichtet. Jede Biographie berühmter Menschen arbeitet damit. Es hätte aber auch ganz anders kommen können. Nur in der Kunst gibt es einen höheren Sinn auch in den kleinsten Dingen. Das ist einer der vielen Gründe, warum ich die Literatur der Realität vorziehe.
Eine Leseprobe des Romans gibt es hier: Sorck: Leseprobe
Unter der Kategorie “Sorck” (im Klappmenü rechts) finden sich weitere Beiträge zum Roman.
Bestellbar ist der Roman auf Amazon (Taschenbuch | Ebook)
Alternativ ist es möglich, das Taschenbuch direkt bei Twentysix oder im Autorenwelt-Shop zu erwerben.
Außerdem ist es möglich, im Buchladen vor Ort ein Exemplar zu bestellen.